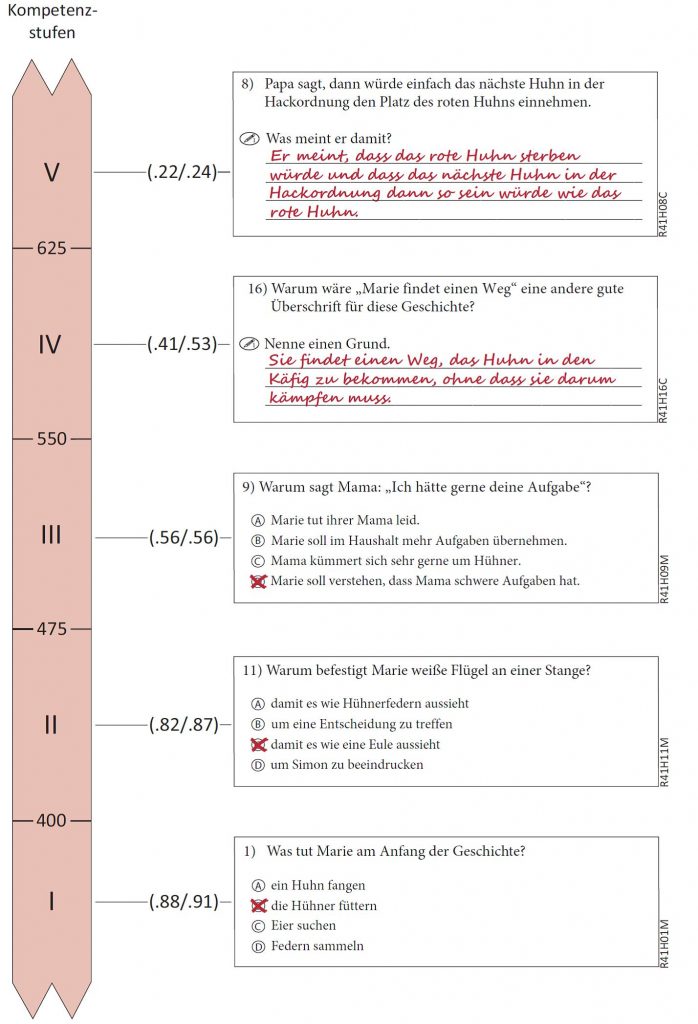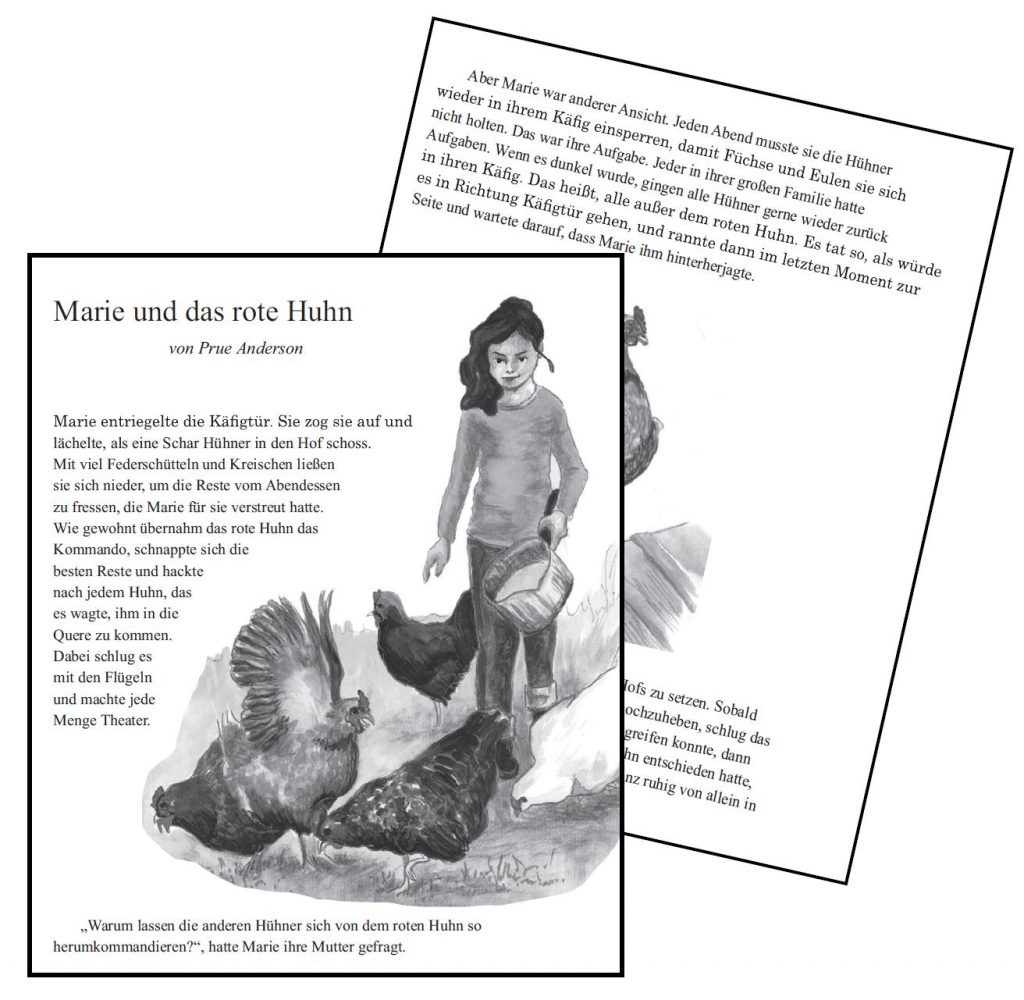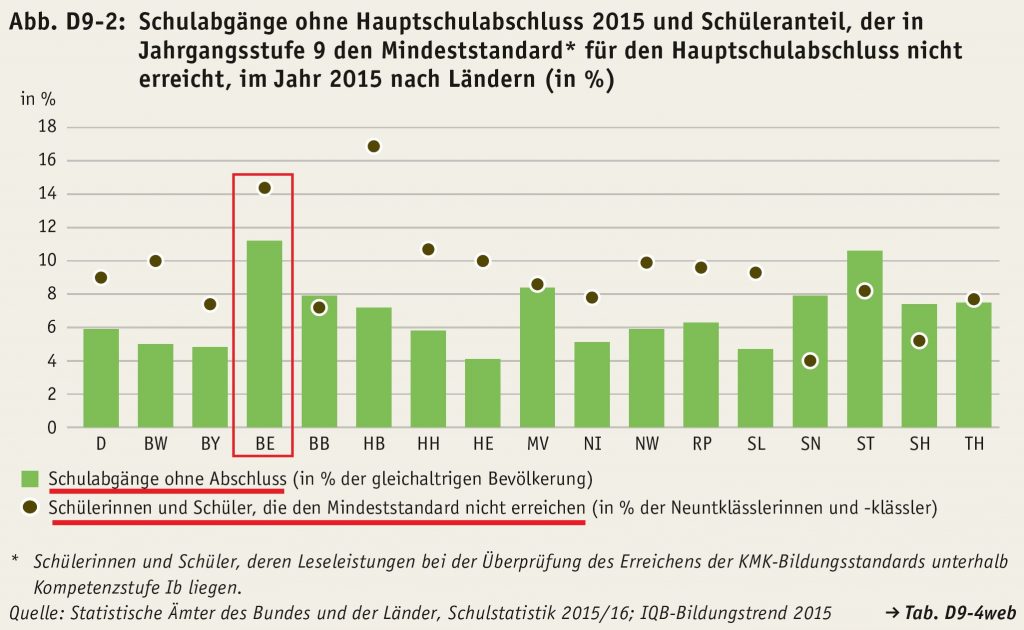Auf dieser Berliner Schule herrschen klare Regeln
Schulleiter Michael Rudolph legt bei seinen Schülern Wert auf Disziplin. Und hat damit offenbar Erfolg.

Foto: Friedrich-Bergius-Schule, Schulforum-Berlin
Berliner Morgenpost, 17.06.2018, Susanne Leinemann
Die altehrwürdige Friedrich-Bergius-Schule, in Friedenau am Perelsplatz gelegen, steht auf der Liste der Brennpunktschulen. Über die Hälfte der Schüler kommen aus Familien, in denen der Staat unter die Arme greift, fast 70 Prozent der Heranwachsenden stammen aus Elternhäusern, in denen nicht Deutsch gesprochen wird. Eigentlich die perfekte Mischung für Brandbriefe. Tatsächlich, 2005 stand die Schule, die heute eine Sekundarschule ohne Oberstufe ist, vor dem Aus. Zu viele Probleme, zu viel Gewalt. Bis Schulleiter Michael Rudolph die Leitung übernahm. Er brachte den Wandel: Die Hälfte aller Schüler schafft inzwischen in der 10. Klasse den Mittleren Schulabschluss (MSA) mit Empfehlung für das Gymnasium, fast alle haben am Ende einen Schulabschluss, und die unentschuldigten Fehlzeiten lagen 2017 im Mikrobereich von 0,5 Prozent. Wie klappt das? Durch klare Regeln. Susanne Leinemann sprach morgens ab 6 Uhr mit dem Schulleiter Michael Rudolph. Wer mit ihm ins Gespräch kommen will, sollte besser früh aufstehen. Und pünktlich erscheinen.
Susanne Leinemann: Gerade wurden Zahlen zur Gewalt an Berliner Schulen veröffentlicht, die erschreckend waren. Ihre Schule spielte in der Diskussion keine Rolle, es ist hier im letzten Jahr beispielsweise keine einzige Körperverletzung verzeichnet, obwohl Ihre Schüler alle im schwierigen Jugendalter sind. Wieso klappt das Zusammenleben hier offenbar besser?
Michael Rudolph: Es stimmt, es kommt relativ selten vor, dass sich hier Schüler gegenseitig ernsthaft an die Gurgel gehen. Ich führe das auf eine Sache zurück: Wir sanktionieren sofort, auch in ganz kleinen Bereichen. Hausaufgabenheft führen, Material dabeihaben, keine Mütze im Schulgebäude. Die Lehrer achten darauf, dass diese einfachen Regeln eingehalten werden, indem sie die Schüler ansprechen. Und wenn ich das System so aufbaue, dass ich niedrigschwellig Grenzen setze, dann sagt die Erfahrung, dass die Schüler sich an diesen niedrigschwelligen Grenzen ausprobieren werden – und nicht die ganz große Nummer fahren, die ganz großen Grenzen austesten. Sollten die Schüler das aber tun, dann wissen sie, dass wir sehr konsequent handeln würden.
Das klingt fast traditionell – einfache Regeln, die eingehalten werden. Haben Sie schon immer so gedacht?
Ich bin jetzt 40 Jahre im Dienst. Am Anfang, ich arbeitete damals in Kreuzberg an Hauptschulen, hatte ich überhaupt keine Vorstellung, was Schule sein sollte. Und dann hat man sehr viele Erfahrungen gemacht – darunter waren gute und auch furchtbar schlimme Erlebnisse. Daran hat sich Stück für Stück diese Art der Pädagogik entwickelt. Heute weiß ich: Wichtig ist, welches Ziel wir in der Schule haben. Das scheint mir häufig unklar zu sein.
Und wie lautet Ihr Ziel?
Wir sollten jeden Schüler so weit entwickeln, wie es möglich ist, damit er nachher in der Lage ist, eigenständig sein Geld zu verdienen und so im Leben zurande zu kommen. Der eine wird Putzmann, die andere Bundespräsidentin, das ist erst mal egal. Jeder soll eine gute Basis erwerben. Deshalb muss man sich überlegen, was sie für ihre Zukunft brauchen.
Und was brauchen sie?
Ich sage es jetzt mal ganz schlicht: Wenn ein Schüler lesen, schreiben und rechnen kann und ein vernünftiges Sozialverhalten hat, wird sie oder er im Leben klarkommen. Auf diese Dinge legen wir einen Schwerpunkt.
Unter vernünftiges Sozialverhalten fällt bei Ihnen auch Pünktlichkeit. Warum betonen Sie das so?
Es hat für Schüler noch nie so eine günstige berufliche Situation gegeben wie heute, die können sich ihre Stelle aussuchen. Eigentlich. Ich habe mit vielen Arbeitgebern Kontakt, höre, was sie in den Betrieben wollen. Die kommen mit vielen Defiziten klar. Was sie aber nicht machen, ist unregelmäßig erscheinende Schüler täglich zu wecken und umzuerziehen. Das kann sich keine Firma leisten. So einen Vogel, von dem ich nicht weiß, ob der kommt oder nicht, kann man nicht gebrauchen. Also muss ich in der Schule eine gewisse Selbstdisziplin lernen.
Was passiert also?
Es läuft bei uns so: Jeden Morgen um 7.25 Uhr geht die Schultür auf, die Schüler strömen rein, und dann klingelt es um 7.30 Uhr zur ersten Stunde. Danach fällt die Tür ins Schloss. Und da wir außen keine Klinke haben, muss jeder, der zu spät kommt, klingeln.
Das Zuspätkommen wird also bemerkt …
Genau. Ob eine Minute oder eine halbe Stunde spielt keine Rolle. Wir sagen zum Schüler oder zur Schülerin: Du darfst nicht gleich in den Unterricht gehen, weil das die anderen stört, die ja arbeiten und was lernen wollen, sondern du wartest, bis die nächste Stunde anfängt. Und währenddessen gehst du mal zum Hausmeister. Der schickt dich beispielsweise auf den Perelsplatz, dort sammelst du Müll ein. Das passiert dann womöglich zwei-, dreimal, dann folgt ein Elterngespräch.
Und wie läuft das?
Ich binde immer die Eltern mit ein, ich will sie ja nicht zu Gegnern machen. Also sage ich zum Schüler, der immer dort sitzt, wo Sie gerade sitzen …
Das ist hier ist also ein durchgeschwitzter Stuhl!
… also ich sage: Erkläre du mir, du Kind, warum wir älteren Leute jetzt hier sitzen, obwohl wir eigentlich alle etwas anderes zu tun hätten. Damit haben wir den Ball dahin gespielt, wo er hingehört – der Schüler ist ja zu spät gekommen. Dann kommt die nächste Frage: Was willst du werden? Häufig folgt bei den Jungs als Antwort: Ich will Profi-Fußballer werden. Das ist deren Traum. Also frage ich, wo willst du spielen? Natürlich bei Bayern München als Mittelstürmer. Dann sage ich: Jetzt überlege mal, der Schiedsrichter pfeift das Spiel gegen Hertha BSC an – und du bist nicht auf dem Platz. Was glaubst du, wie oft du das machst? Da versteht jeder Schüler, dass das nicht geht.
Und danach ist alles gut?
Immer wenn es um Regeln geht und um die Übertretung von Regeln, muss es danach etwas geben, was kommt, wenn es auch nach dem Gespräch nicht besser wird. Also sage ich dann: Ich helfe dir noch ein bisschen, damit du es schaffst. Wir alle hier, deine Eltern und ich, glauben dir zwar, dass du ab jetzt nicht mehr zu spät kommst. Wenn es aber dennoch passiert, dann kommst du mal eine Woche um 6.30 Uhr und hilfst dem Hausmeister. Von zehn Schülern, denen wir das sagen, sind danach neun pünktlich.
Wie finden die Schüler diese Konsequenz, manche würden womöglich sagen Härte?
Man sollte annehmen, dass solche Regeln und Sanktionen den Schülern nicht gefallen. Nun wird es tatsächlich den Schülern nicht unbedingt gefallen, wenn sie den Hof fegen müssen. Aber innerlich verstehen sie schon, dass es wichtig ist für sie, dass wir uns um sie kümmern und ihnen sehr wohl emotional zugeneigt sind. Es wäre doch viel einfacher für uns zu sagen, kümmert uns nicht. Macht euren Kram, ich setze mich in die Ecke, und ihr Schüler tobt alle herum. Das wäre scheinbar erst mal eine gute Sache für die Schüler. Aber Schüler wollen eigentlich, dass Erwachsene sich mit ihnen auseinandersetzen. Dass sie ihnen Dinge vorgeben – und dann wollen sie auch dagegen verstoßen. Das haben wir auch gemacht in der Jugend. Die Schüler wollen dann auch, dass wir sehen, dass sie Mist gebaut haben und wir eine kleine Grenze setzen. Das ist durchaus von den Schülern akzeptiert.
Woran merken Sie das?
Bei uns schaffen viele, rund die Hälfte, den Übergang auf eine gymnasiale Oberstufe. Das sind für eine Schule, wie wir das sind, extrem viele. Was uns besonders freut, ist, dass sie den Übergang tatsächlich schaffen. Viele kommen später vorbei und sagen, die Zeit hier war wichtig. Ich habe hier gelernt, zu lernen, mich hinzusetzen, pünktlich zu sein.
Wie sieht es im Unterricht aus? Was ist Ihnen dort wichtig?
Wir haben Schüler aus über 40 verschiedenen Berliner Grundschulen. Es sind immer genug dabei, die, wenn sie zu uns kommen, massive formale Defizite haben. Die laufen durch den Unterricht, weil sie es so gewohnt sind. Wenn die eine Frage haben, stehen sie einfach auf und rennen zum Lehrer. So kann man keinen Unterricht machen.
Wie kriegen Sie das in den Griff?
Am Anfang der siebten Klasse gehen sowohl meine Stellvertreterin als auch ich in die Klassen hinein und übernehmen einzelne Unterrichtsstunden. Es geht dabei nicht um Fachunterricht, sondern um das Einüben von Regeln. Ich mache beispielsweise die formalen Sachen. Wie macht man ein Inhaltsverzeichnis, wie einen geraden Strich mit einem Lineal? Das hört sich jetzt albern an. Aber das ist absolut notwendig, weil die Schüler oft keine Hefte mehr führen können. Sie haben die Ordnungsprinzipien nie gelernt. Nach diesen Stunden braucht der Fachlehrer nur sagen: Du hast es doch von Herrn Rudolph gelernt. Das erleichtert den Schulalltag.
Das klingt aber überhaupt nicht modern – dort geht es ja ständig um Auflösung, um Gruppen- und Projektarbeit …
Diese ganzen Kriege um Methoden und um Reformen kann man vernachlässigen. Ich denke, wir in den Schulen sollten uns stärker darum bemühen, auf die Ergebnisse zu gucken. Wenn jemand nach den ersten sechs Jahren Schule, das sind 60 Prozent der Schulzeit von zehn Schuljahren, hier ankommt und ich frage, was ist 3 x 9? Und der Schüler kann das auch nach Nachdenken nicht herausbekommen, dann kann irgendetwas nicht richtig gelaufen sein. Mir ist völlig egal, wie das kleine Einmaleins gelehrt wurde, ob in Jahrgangsübergreifendem Lernen (JüL), im Kopfstand oder frontal – die Schüler müssen es lernen. Wenn sie es nicht können, dann müssen wir uns fragen, wie bringen wir denen es bei? Das kleine Einmaleins ist nicht modern, es ist mindestens 3000 Jahre alt. Wir haben also 3000 Jahre pädagogische Erfahrung, wie man das erlernt. Und man hat nur eine Methode gefunden, es beizubringen: sich hinsetzen und lernen.
Oh, da würde aber mancher Pädagoge aufschreien: Stupides Lernen macht keinen Spaß, frustriert womöglich das Kind!
Gegen Spaß ist nichts einzuwenden. Es ist nur die Frage, wie man diesen Spaß einsetzt. Spaß sitzt oft nicht am Anfang. Aber wenn ich etwas gelernt habe und es plötzlich kann, dann kommt die Freude. Ich habe mich angestrengt, es war auch übel, gefallen hat es mir auch nicht immer, aber ich kann das jetzt.
Und die Frustration?
Jeder Mensch hat im Leben Misserfolge, machen wir uns nichts vor. Ich erlebe oft Schüler, die kommen und sagen: Geschichte macht mir keinen Spaß. Oder Mathe macht mir keinen Spaß. Dann sage ich, das kann ich sogar verstehen, dass dir Mathe nicht so gut gefällt; mir hat das auch nicht gefallen. Aber du musst auch lernen, das zu machen, was dir keinen Spaß macht. Es ist die Lebenserfahrung eines jeden Menschen, dass nicht immer alles schön ist. Das muss man lernen, wenn man gut durchs Leben kommen will.
War eigentlich immer klar, dass Sie Lehrer werden?
Nein, ich bin ein kleines Arbeiterkind, das ist für Lehrer eher ungewöhnlich, denn meist kommen Lehrer aus dem Mittelstand. Ich war dann auf einem Lichtenrader Gymnasium, damals wurden auch schon kräftig Reformen gemacht, das war um 1968. Und damals habe ich auch erlebt, wie menschlich es ist, ein bisschen faul zu sein. Ich bekenne mich auch zu meiner Faulheit.
Aber können Sie Ihren Schülern nicht auch diese Faulheit gönnen?
Ich denke, das wäre nicht richtig. Denn wenn wir hier auf dem Schulhof graben würden, da würde Sand kommen und Wasser. Mehr ist da nicht. Und das können wir in Deutschland überall machen, wir haben eigentlich nichts. Wir sind ein armes Land. Das Einzige, was wir haben, sind Menschen. Menschen, die intellektuell gut ausgebildet sind, die Fähigkeiten haben, Dinge zu konstruieren, Dienstleistungen anzubieten, irgendetwas. Das ist unser Reichtum. Und in den Schulen müssen wir doch den Grundstein dafür legen, dass das auch in Zukunft so weitergeht.
Um 6 Uhr morgens haben wir mit dem Gespräch begonnen, nun verlassen wir das Direktorenzimmer, gehen hinunter in die schöne Säulenhalle. Es ist 7.25 Uhr, der Direktor steht am Eingang, die Schüler strömen hinein. Es ist lebendig und wuselig wie an jeder Schule. Um 7.30 Uhr ist die Tür dann zu. Und dann passiert es, zwei junge Mädchen aus der 8. Klasse kommen einige Minuten zu spät. Schulleiter Rudolph erkundigt sich und erfährt, die eine klingelt ihre Mitschülerin wohl jeden Morgen aus dem Bett, damit die es zur Schule schafft, sonst würde es wohl niemals klappen mit dem regelmäßigen Schulbesuch. Dafür geht sie extra eine halbe Stunde früher los. „Aber heute war die Haustür zu, niemand hat aufgemacht“, erzählt sie. Rudolph findet das Engagement toll, lobt sie. Trotzdem, es hilft nichts, zu spät ist zu spät. Also schnappen sich die beiden Mädchen die Metallkörbe und Abfallzangen und gehen hinaus auf den Perelsplatz. Ein Glück ist das Wetter schön.
zum Interview: Berliner Morgenpost, 17.06.2018, Susanne Leinemann, Auf dieser Berliner Schule herrschen klare Regeln
Lesen Sie nachfolgend die Einschätzung des Inspektionsteams der Schulverwaltung zu der Arbeit des Lehrerkollegiums der Friedrich-Bergius-Schule.
Berlin hat eine überraschende neue Problemschule
[…] Seit einigen Tagen ist Berlin, das an Problemschulen eh nicht arm ist, nun um eine solche reicher. „Wir haben leider keine guten Nachrichten“, so sprach das dreiköpfige Inspektionsteam zu dem perplexen Lehrerkollegium der Friedrich-Bergius-Schule, einer Sekundarschule, in der man bis dato gedacht hatte, man leiste richtig gute Arbeit.
Diesen Schluss lassen auch Teile des aktuellen Inspektionsberichts zu: Das Klima im Unterricht wird darin als zu annähernd 100 Prozent freundlich und zugewandt dargestellt, „niemand wird ausgegrenzt“, die Lernatmosphäre sei „angstfrei“. Man beginne morgens pünktlich, der Unterricht sei für die Schüler nachvollziehbar, Wissen werde gut vermittelt. Mit einem Wort: Dies ist eine Schule, an der gelernt wird. Die ihre Schüler bestmöglich gebildet ins Leben entlässt. Trotzdem ist sie bei der Schulinspektion durchgefallen. Denn am Ende steht fest: „Schule mit erheblichem Entwicklungsbedarf“. […]
Man muss es sich nochmal klarmachen – hier ist eine Schule, die tut, was eine gute Schule tun soll. Sie bringt den Schülern etwas bei. Und zwar so erfolgreich, dass die Leistung überprüfbar ist, weil man merkt, dass die Kinder einen guten Schulabschluss in der Tasche haben. Und damit die Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft, frei von Hartz IV und Sozialamt. Schüler gehen gern hierher, das Klima ist gut. Es gab aktuell keine Meldungen von Gewalt an dieser Schule, kein Mobbing wurde bekannt, Schulschwänzen wird sofort geahndet, deshalb gibt es das kaum. Doch all diese Dinge werden von der Schulinspektion nicht anerkannt, nicht gewürdigt. Die Haltung der Prüfer scheint zu sein: Ja, diese Schule erreicht die richtigen Ziele. Aber auf dem falschen Weg. […]
Die Schulinspektoren beschlich eine Ahnung, dass ihr Bericht den Lehrern, Eltern, Schülern und auch der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln sein würde. Wieso um alles in der Welt werden schulischer Erfolg, schulische Leistung, sozusagen das Kerngeschäft einer jeden Schule, so gar nicht gewürdigt? Warum wird zwar immer wieder betont, wie eigenverantwortlich Schulen sein sollten, wenn diese Eigenverantwortung offenbar nicht so weit reicht, dass man innerhalb eines akzeptierten Rahmens seine Lehrformen selbst aussuchen darf? Also bauten sie noch einen sehr schwerwiegenden Vorwurf in ihren Bericht ein: Die Bergius-Schule verstoße gegen das Recht! […]
zum Artikel: Berliner Morgenpost, 04.07.2018, Susanne Leinemann, Wie Berlins Verwaltung eine gute Schule für schlecht erklärt
Das Schuforum-Berlin möchte Sie auf einen aktuellen Radiobeitrag hinweisen, der sich den Merkwürdigkeiten von Schulinspektion und Qualitätsanalyse widmet:
Überdurchschnittliche Abschlüsse, ein gutes Lernklima, Zuspruch von Schülern und Eltern. Eine Schulerfolgsgeschichte – sollte man meinen. Nicht wenn die Ergebnisse von fehlgeleiteten Schulinspektoren bewertet werden – wie jüngst an einer Berliner Schule, klagt der Pädagoge Michael Felten.
zum Radiobeitrag: https://www.deutschlandfunkkultur.de/bildungsdebatte-schulleistungen-spitze-aber-mit-den.1005.de.html?dram:article_id=426954
Zum Vorgehen der Bildungsverwaltung siehe:
Jochen Krautz, Matthias Burchardt (Hrsg.) in dem soeben erschienen Buch: Time for Change? (siehe nebenstehende Bücherliste).
Schulen stehen unter dauerndem Reformdruck unter dem Label ‚Schulentwicklung‘: Kompetenzorientierung, Vergleichstests, zentrale Prüfungen, individuelle Förderung, dauernde Rechenschaftslegung, Schulprogramme, Steuergruppen, Qualitätsmanagement, Schulinspektionen usw. sollen Schule besser machen. Im Erleben vieler Lehrerinnen und Lehrer bewirken sie faktisch das Gegenteil: unsinnige Arbeitsverdichtung durch Bürokratisierung, Ablenkung vom Kerngeschäft Unterricht, Normierung von Didaktik und Methodik, Kontrolle und Verlust der pädagogischen Freiheit, subtiler oder offener Anpassungsdruck durch Schulleitungen und Behörden etc.
Die Reformen kommen dabei in der emphatischen Sprache völliger Alternativlosigkeit daher: „Time for Change – Es ist Zeit für den Wandel!“ Neu ist immer besser; wer nicht mitmacht, ist von gestern – und wird mit sanftem oder unsanftem Druck auf die neue Linie gebracht. Dazu werden zunehmend sozialpsychologische Steuerungsinstrumente des sog. „Change Managements“ eingesetzt. Statt Sachdiskussionen zu führen, wird in gruppendynamischen Settings an „Einstellungen“ gearbeitet. Widerspruch wird als Querulantentum beiseitegeschoben. Oder Kritiker werden durch Vorgesetzte und Schulverwaltung direkt eingeschüchtert und gemaßregelt. So sollen Lehrer unter Druck gesetzt werden, sich von ihren begründeten pädagogischen Überzeugungen zu verabschieden:
Sie sollen wollen, was sie sollen!
Lehrer brauchen Rückgrat und Haltung
Viel zu oft lassen Lehrer sich einschüchtern. Ein Aufruf zu pädagogischem Ungehorsam.
Bereits am 31.01.2013 – und heute genauso aktuell – schrieb Michael Felten in der ZEIT:
Eigentlich ist die Sache mittlerweile klar: Gute Lehrer sind nicht nur begleitende Beobachter, sondern vor allem auch geschickte Aktivatoren: erwartend, erklärend, ermutigend, einfordernd. Folglich kann guter Unterricht gar nicht anders als lehrerzentriert sein. Im Zentrum steht der Pädagoge – für den allerdings seine Schüler im Zentrum stehen. So bilanziert jedenfalls der Erziehungswissenschaftler Ewald Terhart die Metastudie des australischen Unterrichtsforschers John Hattie zu den Wirkungsbedingungen schulischen Lernerfolgs. Eine Bilanz, die erfahrene Praktiker wenig verwundert – und einen plausiblen Ausweg aus mancher Reformhuberei weist. […]
Auch das Anrücken der Abteilung für die Qualitätsanalyse ist nicht wirklich gefährlich – trotzdem verhalten sich ganze Kollegien plötzlich wie eine ängstliche Kinderschar angesichts des autoritären Vaters. Warum werden plötzlich Vorführstunden vorbereitet, die weder vom Arbeitsaufwand noch vom Materialeinsatz, noch von der Unterrichtsform her zielführend und alltagstauglich sind? Ist das jetzt eigentlich Abgeklärtheit (schließlich folgt der nächsten Wahl wahrscheinlich die nächste Pädagogik) – oder auch eine Portion Duckmäuserei? Warum zeigen erfahrene Lehrpersonen nicht den Unterricht, der sich an ihrer Schule, in ihrem Fach, mit ihrer Schülerschaft bewährt hat? Zumal die Qualitätsanalyse ja nicht einzelne Lehrer beurteilt, sondern nur die gemittelte Arbeitsweise des gesamten Kollegiums dokumentiert, und das nicht mal öffentlich.
Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein kritischer Bericht der Inspektoren – und damit die Verpflichtung des Kollegiums zur gemeinschaftlichen Fortbildung. Aber könnte man dort nicht die Probleme übertriebener Selbstständigkeit und das Potenzial differenzierter Lehrerlenkung debattieren? Vielleicht hätten zuvor gar ein, zwei Unverfrorene im Lehrerzimmer einen Sammelordner angelegt mit fundiertem Material über das Für und Wider bestimmter Lehr- und Lernformen. Dann würde sich schon zeigen, ob die Fortbilder nur lokale Spindoctoren sind, die Organisationsmethoden aus dem Unternehmensmilieu ins Pädagogische einschleppen – oder ob sie tatsächlich etwas vom Unterrichten verstehen. […]
Es ist eben kein Geheimnis, dass Schulinspektoren bisweilen zu eher bizarren Befunden kamen – »gute Leistungsergebnisse, aber falsche Unterrichtsmethoden«, hieß es dann sinngemäß. Genau diese Paradoxie könnte letztlich erleichtern: Die Evaluationskriterien entstammen offenbar nicht göttlicher Offenbarung, sondern einem laufenden, noch offenen, je nach Bundesland und Wahlperiode mäandrierenden Prozess. Irgendwann werden sich die Hattie-Befunde auch in den mittleren Amtsstuben herumgesprochen haben. Bis dahin könnte der gemeine Schulmeister doch ruhig zur Avantgarde von morgen gehören.
Michael Felten hat 35 Jahre Mathematik und Kunst an einem Gymasium in Köln unterrichtet. Er ist weiterhin in der Lehrerausbildung tätig, berät Schulen bei ihrer Entwicklung (www.eltern-lehrer-fragen.de) und ist Autor verschiedener Bücher (siehe nebenstehende Bücherliste). Ihm geht es darum, den Praxiserfahrungen der Lehrer und den Befunden der Unterrichtsforschung mehr Gehör in der Bildungsdebatte zu verschaffen. Seit dem UN-Weltkindertag 2015 betreut er eine Info-Plattform zur Inklusionsdebatte: www.inklusion-als-problem.de