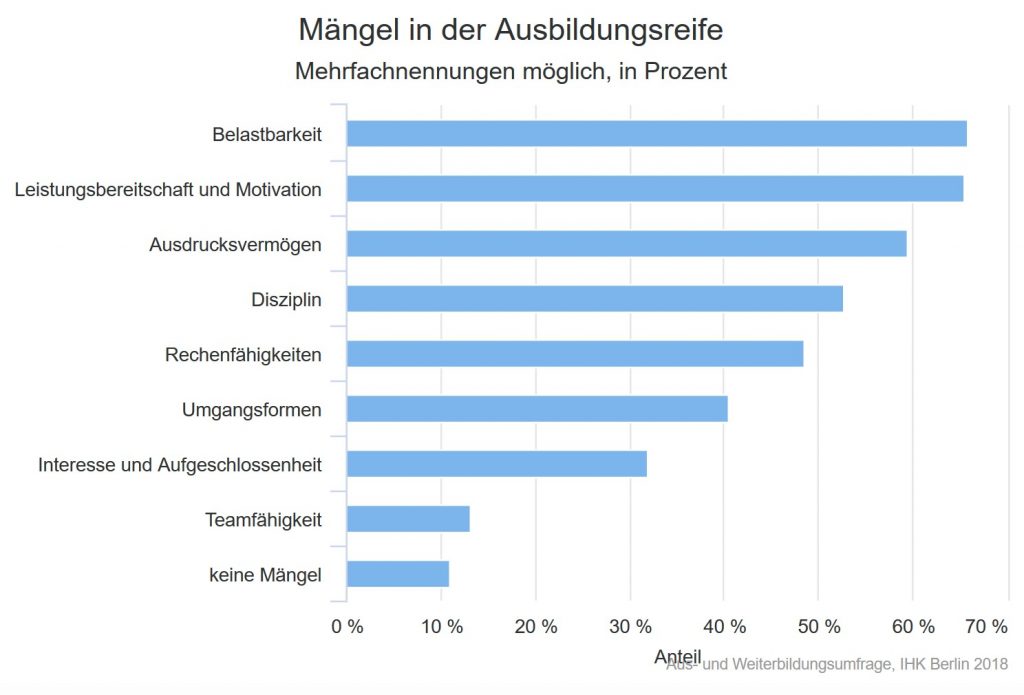Was kommt heraus, wenn eine Schule sich strikt nach Hattie und Co. ausrichtet? Ein bemerkenswert traditionell arbeitendes Kollegium
NEWS4TEACHERS, 21.03.2019, Andrej Priboschek
Auf dem Deutschen Schulleiterkongress (DSLK) stellte der Aschaffenburger Direktor Michael Lummel sein Prinzip einer strikt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeitenden Schule vor. Das Erstaunliche: Heraus kommt ein wohltuend konservatives Gymnasium, das auf Förderung und bewährte Unterrichtsmethoden setzt – sich gleichwohl vor Innovationen nicht verschließt. Aber nur dann, wenn sie nachweislich Erfolg versprechen.
Inoffizieller Auftakt zum Deutschen Schulleiterkongress vom 21. bis 23. März 2019 in Düsseldorf: Am „Vor-Kongress-Tag“ vor der offiziellen Eröffnung stehen Workshops für Schulleitungen auf dem Programm. Einerseits zur Selbstoptimierung von Führungskräften: darunter „Ihre Strategie für mehr Gelassenheit im Leistungsalltag“, „Werkzeugkoffer Körpersprache“ oder (stark besucht!) „Wenn es knallt … – Überwinden Sie Widerstand und Verweigerung im Kollegium mit Ihrer Konfliktmanagementstrategie“. Andererseits Programme zur Schulentwicklung: „Entwickeln Sie einen Masterplan zur Digitalisierung Ihrer Schule“ [siehe auch nachfogender Beitrag auf Schulforum-Berlin] etwa oder „Ihr Konzept für mehr Zusammenhalt im multiprofessionellen Team“.
Unter den Referenten fällt ein Schulleiter auf – Michael Lummel, Direktor des Friedrich-Dessauer Gymnasiums in Aschaffenburg. Er präsentiert ein besonderes Thema: sich selbst, genauer: seine Art, die Schule nach wissenschaftlichen Kriterien zu leiten. Titel des Workshops: „Ohne Fleiß kein Preis! Von der Hattie-Theorie zur Entwicklungsstrategie für Ihre Schule“.
Mit der „Hattie-Theorie“ sind die Erkenntnisse von John Hattie gemeint, dem wohl berühmtesten Bildungsforscher der Welt. Der neuseeländische Professor hat 50.000 Studien mit den Daten von insgesamt 236 Millionen Schülern zu einer Meta-Studie zusammengefasst und daraus Erkenntnisse gezogen, welche Maßnahmen in Schule und Unterricht tatsächlich leistungsfördernd wirken. Für Schulleiter Lummel bieten Hattie und die empirische Bildungsforschung überhaupt „einen inneren Kompass“, nach dem er Entscheidungen ausrichten kann. Heraus kommt nach Lummels Schilderung eine Schule, die in vielen pädagogischen Fragen konservativer tickt, als man zunächst annehmen könnte. Gleichwohl lassen sich Schulleitung und Kollegium hin und wieder auch auf Neuerungen ein, die exotisch anmuten – tatsächlich aber stets wissenschaftlich begründet werden können.
Der Reihe nach: „Häufig ist nicht der Widerstand gegen Reform das Problem, sondern die unkritische Akzeptanz von zu viel Innovation“, sagt Lummel. Anders ausgedrückt: „Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben.“ Ob die Neuerung aber tatsächlich die Lernergebnisse verbessert, werde selten im Vorhinein eruiert – mit der Folge, dass allzu häufig echte Erfolge ausblieben und sich Erschöpfung und Frustration unter den Akteuren breitmache.
Ein Beispiel: offener Unterricht. Schulen, in denen Kinder in „Lernlandschaften“ sich selbstständig und interessengeleitet Wissen aneignen sollen, würden mit Schulpreisen bedacht und in Medien gefeiert. Die Ergebnisse der empirischen Forschung aber seien diesbezüglich „extrem ernüchternd“. In Mathematik beispielsweise sei ein Unterricht „durch einen Lehrer, der’s studiert hat und der den Stoff strukturiert, deutlich besser als zu sagen: Erarbeitet Euch das mal selber“. Auch der immerzu geforderte Realitätsbezug in Mathe sei zwar „am Zeitgeist orientiert“ – habe aber bei Hattie eine Effektstärke nahe null ergeben. Mit anderen Worten: bringt praktisch nichts. („Herr Lummel, Sie haben mein Leben zerstört“, so habe eine Referendarin ihm diese Erkenntnis quittiert, berichtet er lächelnd). „Lasst es auch ruhig mal abstrakt sein“, schlussfolgert der Direktor, selbst ursprünglich Lehrer für Englisch und Geschichte.
“Muss das auch noch sein?”
Hohe Effektstärken – und pädagogische Erfolge in der Praxis seiner Schule – brächten dagegen eher tradierte Lernformate, Förderkurse für „Wackelschüler“ beispielsweise (und die dann auch zumeist frontal). Diese „Direct Instruction“ bedeute aber nicht, dass der Lehrer stundenlang vor sich hin doziere – im Gegenteil: Kurze, knackige Erklärungsphasen. Und dann: möglichst viel Übungszeit [siehe dazu mehr auf Schulforum-Berlin]. Sogar Leseförderung haben Lummel und sein Kollegium deshalb an seiner Schule eingeführt – an einem Gymnasium, das gute Schüler voraussetzt, eine ungewöhnliche Maßnahme. Gleichwohl reifte im Kollegenkreis die Erkenntnis, dass geschätzt zehn Prozent der Kinder nicht als ausgereifte Leser aus der Grundschule kommen – das dann eingeführte Förderkonzept baut, natürlich, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Ebenso übrigens wie eine Innovation, die ihm selbst zunächst ein gernervtes „Muss das auch noch sein?“ entlockt habe, gestand Lummel. Ein Lehrer seines Kollegiums sei zu ihm gekommen und habe Hometrainer für seine Klasse haben wollen. Lummel ließ sich durch die Expertise der Universität Wien überzeugen, dass die Sportgeräte im Unterricht wirklich gesundheits- und konzentrationsfördernd seien. Ergebnis, so Lummel: „Das war in den vergangenen zwei Jahren unsere beliebteste Klasse.“
Mitunter stößt aber die Wissenschaftlichkeit auch an Grenzen – bei der Frage beispielsweise, ob die Schule das Doppelstundenprinzip einführen soll. Er habe alle namhaften Bildungsforscher in Deutschland kontaktiert und gefragt, ob Einzel- oder Doppelstunden grundsätzlich lernförderlicher seien, berichtete Lummel, aber von allen die Antwort erhalten: keine Ahnung, das haben wir nicht erforscht. Für Lummel hieß das in der Konsequenz: keine Umstellung des gesamten Stundenplans. „Wenn ich eine Reform angehe“, so der Schulleiter, „dann brauche ich Hinweise, dass die wirklich etwas bringt. Sonst lasse ich’s.“
Der Deutsche Schulleiterkongress (DSLK) ist die jährlich stattfindende Leitveranstaltung für schulische Führungskräfte in Deutschland.
Grau unterlegte Einschübe und Hervorhebungen im Fettdruck durch Schulforum-Berlin.
zum Artikel: NEWS4TEACHERS
Mehr zu den Forschungsergebnissen von John Hattie unter: https://schulforum-berlin.de/category/hattie-studie-visible-learning/