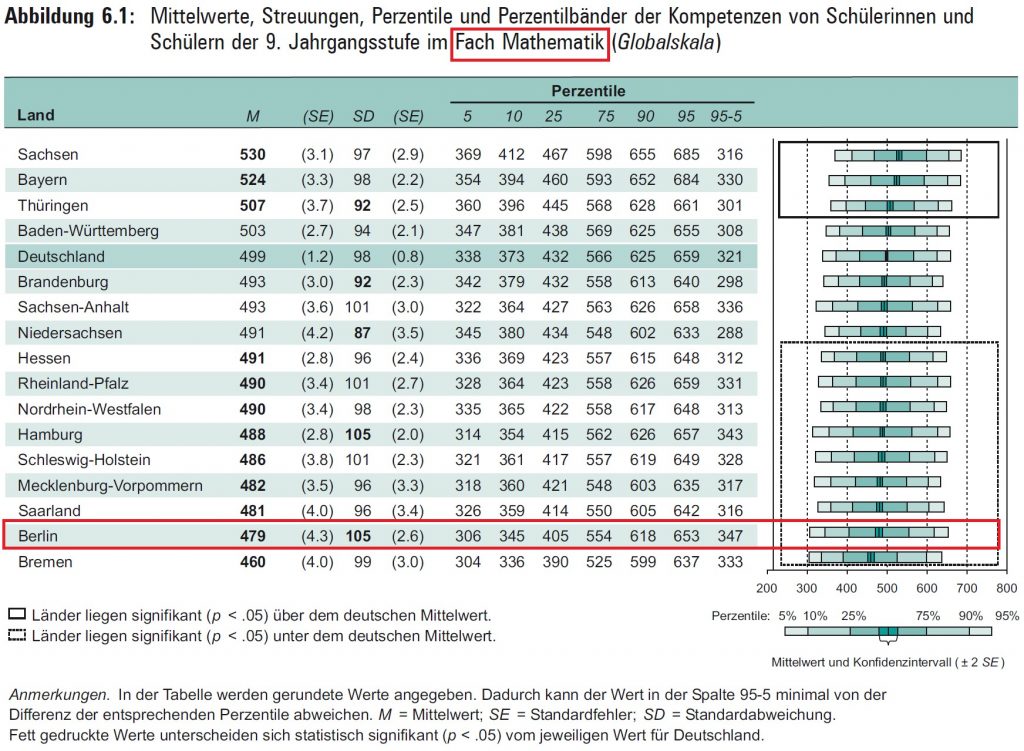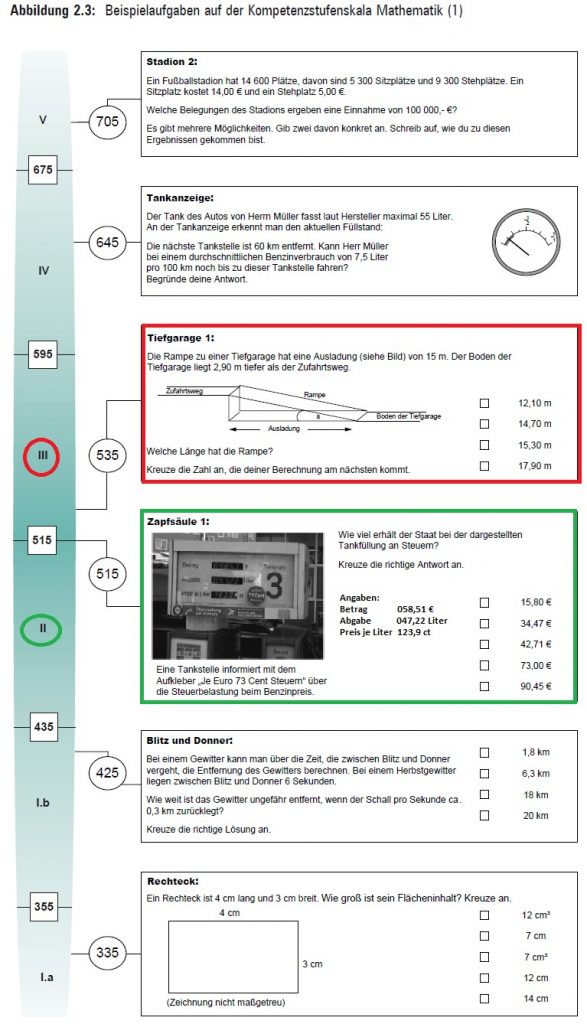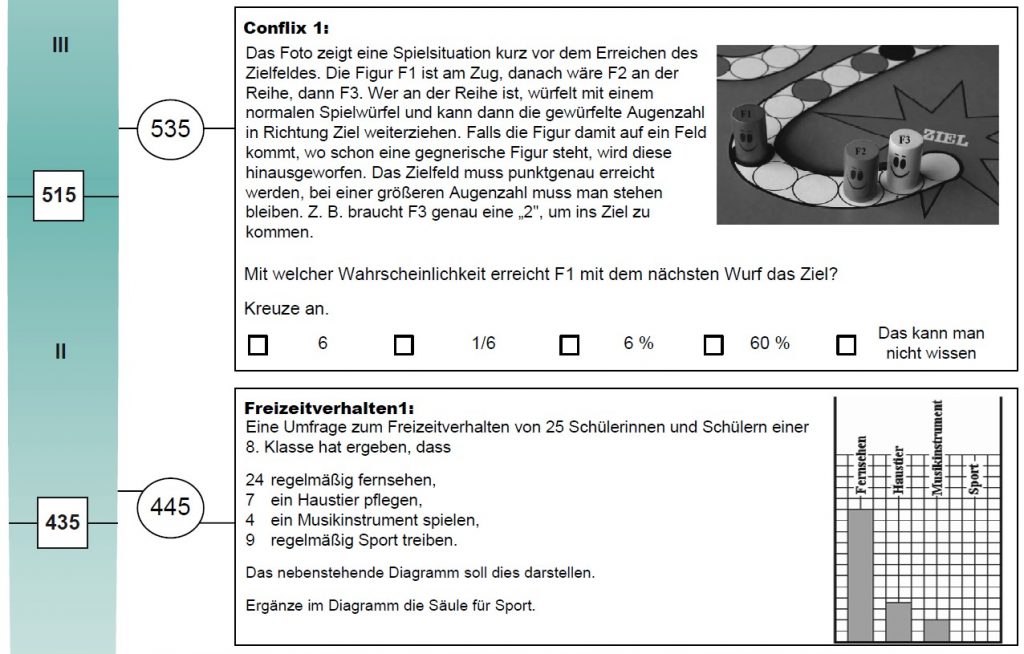Nils B. Schulz
Dr. Nils Björn Schulz ist Lehrer am Robert-Havemann-Gymnasium in Berlin.
Auch im Bildungsbetrieb gibt es sie: die „ewig Morgigen“. So bezeichnet der Schweizer Pädagoge Carl Bossard in Anlehnung an Erich Kästner all diejenigen, die das Neue unkritisch begrüßen: Morgen wird alles besser. Wir brauchen nur mehr Innovation, mehr Digitalisierung, mehr Kompetenzraster, gleichzeitig auch mehr Individualisierung, mehr Differenzierung, mehr selbstorganisiertes Lernen – und das alles immer schneller. Die Gegenwart ist für Modernisierungseuphoriker ein bloßes „Noch-Nicht“. Wenn irgendeine neue Unterrichtsform, Methode oder Verwaltungssoftware nicht funktioniert, dann deswegen, weil sie „noch nicht“ richtig „umgesetzt“ oder „implementiert“ ist. Der technizistische Newspeak verrät, dass es mehr um Sozialtechnokratie als um Bildung geht; und so wird nun seit dem „PISA-Schock“ eifrig reformiert und enthusiastisch digitalisiert. Viele Lehrer:innen und Schüler:innen fühlen sich seit Jahren „im Hamsterrad“ der auf Dauerreform abgestellten Neuen Lernkultur.
Jetzt aber zeigte die Schulschließung und die sukzessive Wiedereröffnung im Frühjahr, dass viele der neuen Lernformen nicht richtig funktionierten. Nicht wenige Schüler:innen waren mit der Selbstständigkeit des „Zuhause-Lernens“ völlig überfordert, obwohl doch seit zwanzig Jahren gerade darauf so viel Wert gelegt wurde. Die „ewig Morgigen“ werden erklären, viele Lehrer:innen hätten die spezifischen Kompetenzen nicht richtig trainiert. Hier gebe es Nachholbedarf. Außerdem wäre das ja eine unerwartete Situation gewesen. Man bräuchte neuere, noch offenere, noch individuellere Aufgabenformate. Und überhaupt: Die digitale Infrastruktur sei ja nicht ausreichend gewesen. Was in diesem Fall auch stimmt. Es fragt sich nur: Wofür nicht ausreichend? Hören wir nicht mehr auf die „ewig Morgigen“! Stattdessen könnten wir aus den Erfahrungen mit der Schulschließung eine schöpferische Ernüchterung verspüren, die den dynamischen Change-Prozess im Bildungssystem in Frage stellt. Mindestens vier Dinge konnte man nämlich in dieser Phase wie durch ein Brennglas wahrnehmen. 1. Schule wird vor allem als außerfamiliärer Aufenthaltsort für junge Menschen benötigt, 2. Schüler:innen brauchen zum Lernen stabile Strukturen und institutionelle Außenhalte, 3. Bildung funktioniert nur in einem leiblichen Beziehungssystem, 4. kleinere Klassen sind lern- und diskussionsförderlich.
Zum ersten Punkt: Als wahre Aufgabe der Schule nannte der Schriftsteller Georg Klein einmal ihre Aufbewahrungsfunktion. Die blanke Not der Alltagsorganisation zwinge uns, die „Energiebündel“ in die Schule zu schicken. Wir müssten unseren Nachwuchs, so Klein, „sechs oder mehr Stunden los sein, um unseren eigenen Kram mit der Welt geregelt zu bekommen“. Und auch für den Nachwuchs ist es nicht das Schlechteste, mal weg von den Eltern zu sein. Die Corona-Krise macht diese Aufbewahrungsfunktion der Schule nun überdeutlich, auch wenn der anvisierte Normalbetrieb im kommenden Schuljahr unterrichtspraktisch und pädagogisch begründet wird. Die „Lernenden“ dürften nicht zu viel Stoff verpassen. „Ziel ist es, einen geregelten, durchgehenden Lernprozess für alle Schülerinnen und Schüler im gesamten Schuljahr sicherzustellen“, so der Berliner Senat. Immerhin gilt Maskenpflicht auf den Schulfluren.
Nun zum zweiten Punkt: Manche Berliner Lehrkraft bemerkte, dass einige Mittelstufen-Schüler:innen während der Schulschließung die digital gestellten Aufgaben nicht sorgfältig oder gar nicht gemacht hatten, auch wenn die private digitale Ausstattung vorhanden war. Sicherlich haben zu viele Aufgaben für Frustration gesorgt; aber vor allem scheinen Selbstverantwortung und eigenständige Zeiteinteilung viele Schüler:innen überfordert zu haben. Es fehlte schlicht der Grenzen setzende Rahmen. Ein Vater berichtete kürzlich in der Deutschlandfunk-Sendung „Schulbeginn in Zeiten von Corona“, dass sein sechzehnjähriger Sohn die zugesandten Aufgaben ständig aufschob, weil er sich selbst keine Tagesstruktur geben konnte. In Berlin kam hinzu, dass die Schüler:innen sicher sein konnten, auch bei Nicht-Bearbeitung ihrer Aufgaben schlimmstenfalls die Halbjahresnote im Zeugnis zu erhalten. Damit fiel auch die Notenstruktur als institutioneller Orientierungsrahmen zumindest für diejenigen weg, die ihre Versetzung sicher in der Tasche hatten. Dennoch war die Entscheidung des Berliner Senats richtig, dass eine Notenverschlechterung den „Ausnahmefall“ darstellen sollte; denn die Lernbedingungen, die häuslichen Unterstützungssysteme und die Digitalausstattung der Kinder und Jugendlichen sind sehr unterschiedlich.
Es macht jedoch nachdenklich, wenn eine Lehrerin während des Inforadio-Podcasts „Schule kann mehr“ klagt, dass sie frustriert sei. Dass Noten eine solche Bedeutung für die Lernmotivation hätten, wäre ihr vor der Corona-Krise nicht so klar gewesen. Warum hatte sie andere Erwartungen? Wahrscheinlich führt die Etablierung der Neuen Lernkultur dazu, dass viele Lehrer:innen inzwischen an Change-Prozesse glauben. Sie glauben anscheinend auch daran, dass „Schule Spaß macht“, wenn sich „Lehrende“ stets innovativ „aufstellen“, wenn sie ihren Schüler:innen „auf Augenhöhe begegnen“, wenn sie ihre Methodik jedes Jahr neu anpassen und die geforderte Kompetenzorientierung mitmachen, wenn sie projektorientiert arbeiten und nach jeder Unterrichtseinheit einen Evaluationsbogen mit Smilie-System herumreichen.
Offenbar sind traditionelle Rahmenbedingungen – sowohl zeitliche als auch räumliche – und eben auch Noten als Lerngrund nötig, und zwar mehr, als es die Neue Lernkultur wahrhaben will. Vor allem aber erkennt man, dass die „aufnahmebegierigen Energiebündel“, wie sie Georg Klein nennt, ebenfalls sehr widerständig sind, vielleicht sogar erwartbar widerständig, und zwar gegenüber den neuen pädagogischen Subjektivierungsformen. Diese werden durch Etikettierungen wie „offen“, „individuell“, „selbstorganisiert“ und „selbstkompetent“ verbrämt und als solche von den Schüler:innen durchschaut. Am Ende steht eben doch die Note: auch für individuelles oder kreatives Handeln.
Da es sich nicht lohnt, in einer Leistungsgesellschaft über die Abschaffung von Noten zu debattieren, weiter zum dritten Punkt: dem Digitalisierungshype der letzten Jahre. Dass die digitale Kommunikation nicht immer funktionierte, weil Systeme zusammenbrachen, E-Mail-Postfächer voll waren, Datenschutzregeln die Nutzung bestimmter Tools verhinderten und einige Schüler:innen und auch Lehrer:innen nicht über die sogenannte digitale Infrastruktur verfügten oder sie nicht beherrschten, ist sicherlich richtig. Doch ist dies kein Argument für „noch mehr“ Digitalisierung im Bildungssystem, sondern allenfalls für stabile und datenschutzsichere Systeme, die man im Notfall eines Lockdowns benutzen kann. Auch hier ist eine nüchterne Bestandsaufnahme wichtig. Denn es wurde vor allem eine Sache deutlich, auf welche die Medienwissenschaftler Ralf Lankau und Paula Bleckmann seit Langem hinweisen: nämlich dass ein Sich-Bilden in leiblichen Beziehungen geschieht. Dauerhafte Bildschirmarbeit führt nicht nur zur Selbst- und Weltentfremdung, sondern richtet auch die Körper zu – und zwar im orthopädischen Wortsinn. Ein Thema, das zunehmend Kinderärzt:innen beschäftigt und im Übrigen auch viele Lehrer:innen im Frühjahr am eigenen Leib verspürten. Rücken-, Ischias-, Augenschmerzen …
Zudem erfuhren die Schüler:innen, dass beim „Lernen zuhause“ Computer-Spiele und Social-Messenger-Dienste nur einen Mausklick von digitalen Lernprogrammen und Aufgaben-Portalen entfernt sind und dass gerade diese Nähe ein Konzentrationshindernis ist.
Wie sehr begrüßte man schließlich die sukzessive Schulöffnung und – um zum letzten Punkt zu kommen – die reduzierten Klassengrößen, die einen lebendigen Austausch im Klassenraum zuließen, ohne dass irgendwo digitale Daten produziert, gespeichert und schlimmstenfalls kapitalistisch verwertet wurden. Der Bildungsforscher John Hattie wies darauf hin, dass bestimmte Lehrmethoden und Formen der Interaktion und des Feedback-Verhaltens wohl besser in kleineren Lerngruppen möglich seien und deswegen das Thema „Klassengröße“ weiter untersucht werden müsse. Man fragt sich jedoch, warum es dafür empirische Belege braucht.
So gab das vergangene Schuljahr einige Antworten auf die Frage: Wozu ist die Schule da? Nun, Schule ist bedeutsam als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Sie ermöglicht im besten Fall gelungene Begegnungen zwischen jungen und älteren Menschen, bietet als traditioneller Lernraum einen festen Rahmen, der stabiler funktioniert als die Formate der neuen Lernkultur, entlastet Eltern und bereitet fachlich auf spätere Studiengänge und Berufe vor. Das mag lapidar klingen, ist aber nicht wenig, und dafür kann man die Schule auch schätzen.
Es überfordert doch Schüler:innen, ständig gute Leistungen erbringen und dabei stets „Spaß haben“ zu müssen, nebenbei noch „Selbstkompetenz“ und „Resilienz“ auszubilden und sich selbst im neoliberalen Sinn zu optimieren. Was von Schüler:innen verlangt wird, vor allem an Aufgaben- und Stoff-Fülle, haben in den letzten beiden Monaten des „Lernens zuhause“ vor allem die Eltern von Gymnasialschüler:innen erfahren. Denn die kompetenzorientierten und inhaltsleeren Lehrpläne führten ja nicht dazu, dass Lernstoff reduziert wurde. Er wurde in manchen Fächern nur beliebiger.
Vielleicht rührt der von vielen Schüler:innen schon seit langem empfundene Schuldruck auch daher, dass sie diese Diskrepanz zwischen Leistungsanforderungen und Spaß- und Autonomiediktat, wenn auch unbewusst, empfinden und nicht auflösen können? Fatal wäre es, wenn man jetzt weiter an der Reformschraube dreht und damit nur die kognitiven Dissonanzen erhöht. Aber dies ist wohl erwartbar – genauso wie die fortschreitende rastlose Digitalisierung. Die Change-Manager und die EdTech-Industrie wird‘s freuen.
Der Beitrag wurde am 26.08 2020 auf der Website der Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V. (GBW) veröffentlicht. Zum Artikel: https://bildung-wissen.eu/fachbeitraege/die-corona-krise-zeigt-wozu-die-schule-eigentlich-da-ist.html
Er ist die ungekürzte Version eines Artikels, der am 15.8.2020 unter dem Titel „Die Coronakrise zeigt, wozu die Schule da ist“ in der „taz“ erschien: https://taz.de/Die-steile-These/!5703228/
Der Artikel erscheint mit freundlicher Genehmigung des Autors auf Schulforum-Berlin.