Ist Individualisierung der Königsweg zum erfolgreichen Lernen? Eine Auseinandersetzung mit Theorien, Konzepten und empirischen Befunden
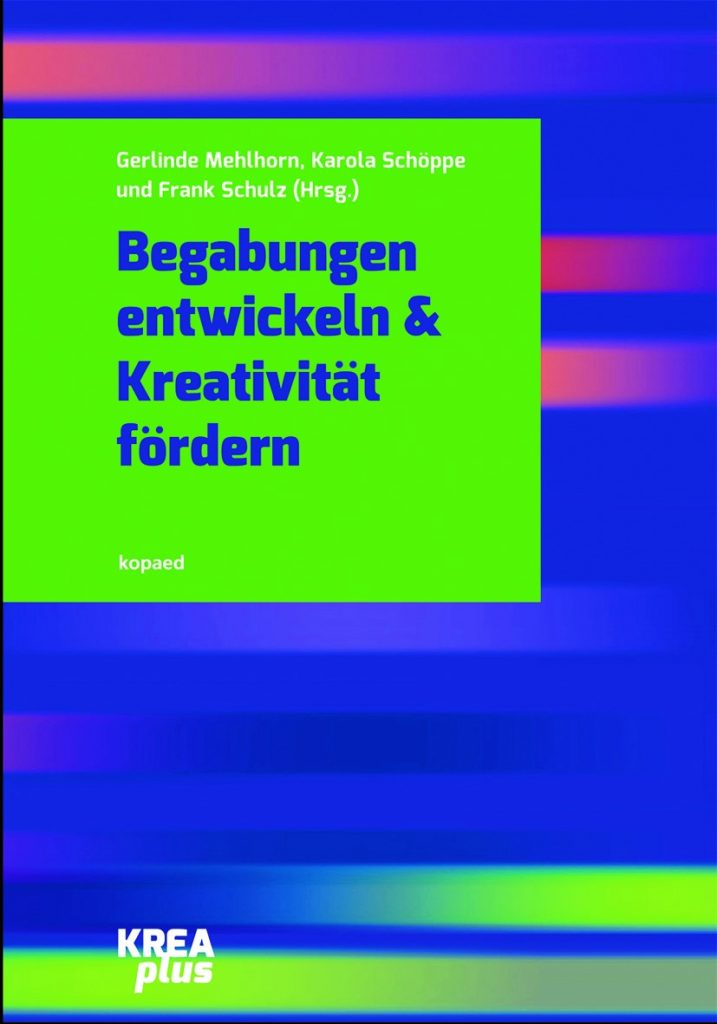 Dr. Frank Lipowsky ist seit 2006 Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Empirische Schul- und Unterrichtsforschung an der Universität Kassel
Dr. Frank Lipowsky ist seit 2006 Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Empirische Schul- und Unterrichtsforschung an der Universität Kassel
Dr. Miriam Lotz ist Akademische Rätin im Fachgebiet Empirische Schul- und Unterrichtsforschung an der Universität Kassel
Auszüge aus: Lipowsky, F. & Lotz, M. (2015). Ist Individualisierung der Königsweg zum Lernen? Eine Auseinandersetzung mit Theorien, Konzepten und empirischen Befunden. In G. Mehlhorn, F. Schulz & K. Schöppe (Hrsg.), Begabungen entwickeln & Kreativität fördern (S. 155-219). München: kopaed
Die Forderung nach einer stärkeren Individualisierung beim Lernen wird als schulpädagogische Antwort auf die wachsende Heterogenität von Schulklassen verstanden: Da die Lernenden so unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen (zsf. Kluczniok, Große & Roßbach 2011, Scharenberg 2012, Trautmann & Wischer 2011), sei es erforderlich, die Lernangebote an den Bedürfnissen der einzelnen Schüler auszurichten und die Lernprozesse weitgehend individualisiert zu organisieren (z. B. Hessischer Landtag 2014). (S. 155)
(…) Auch wenn mit dem Begriff der Individualisierung tatsächlich unterschiedliche Bedeutungen assoziiert werden: Gemeinsam scheint diesen Verständnissen zu sein, dass die Anpassung der unterrichtlichen Angebote an die Bedürfnisse einzelner Schüler herausgestellt wird und dass daraus folgend Unterrichtsphasen, in denen die Schüler individuell für sich arbeiten, für bedeutsamer und wichtiger gehalten werden, während Kommunikations- und Interaktionsprozesse, die auf die Auseinandersetzung mit Mitlernenden und die Interaktion mit der Lehrperson angewiesen sind, in den Hintergrund rücken. (S. 159f)
Nach den bisherigen Studien, die individualisierten Unterricht und Formen von Binnendifferenzierung genauer untersuchen, erfüllen sich die Erwartungen, die man mit diesen Formen des Unterrichts verbindet, nicht in dem erhofften Maße. Hattie (2013) gelangte zum Ergebnis, dass individualisierter Unterricht im Mittel einen lernförderlichen Effekt von d = 0.23 hat, was einem schwachen Effekt entspricht (zur Bedeutung von Effektstärken vgl. Lotz & Lipowsky in diesem Band [Die Hattie-Studie und ihre Bedeutung für den Unterricht – Ein Blick auf ausgewählte Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion]). Auch die mittlere Effektstärke für binnendifferenzierenden Unterricht ist mit d = 0.16 nicht größer, das heißt Schüler, die in einem Unterricht mit binnendifferenzierten Angeboten lernen, lernen nicht viel mehr dazu als Schüler in einem Unterricht, in dem keine binnendifferenzierende Maßnahmen angeboten werden.
Diese eher geringen Effekte über alle [auch ältere] Studien hinweg überraschen zunächst und werfen die Frage auf, warum sich die Erwartungen, die man mit einer zunehmenden Individualisierung verbindet, vielfach nicht erfüllen. Wie im weiteren Verlauf des Beitrags dargestellt wird, spricht vieles dafür, dass Individualisierungs- und Differenzierungsmaßnahmen im Unterricht deshalb eine so geringe Effektivität haben, weil es an der Qualität der Umsetzung mangelt und weil die entsprechenden Maßnahmen häufig nicht vertiefte Lernprozesse auf Seiten der Schüler anstoßen können (…) (S. 162f)
(…) Unterricht im Allgemeinen und Formen von Individualisierung im Besonderen zielen darauf ab, möglichst alle Lernenden gemäß ihrer individuellen Voraussetzungen zu fördern (Leistungsförderung). Häufig wird mit der Forderung nach einer stärkeren Individualisierung auch die Erwartung verknüpft, dass damit die Leistungsunterschiede zwischen leistungsstärkeren und -schwächeren Schülern verringert werden können (Leistungsausgleich).
Nach allem, was in der Forschung bislang bekannt ist, sind Formen der Individualisierung nicht oder allenfalls bedingt geeignet, die Leistungsschere zwischen stärkeren und schwächeren Schülern zu verringern, sofern man diese kompensatorische Funktion überhaupt als Ziel verfolgt. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sich die Leistungsschere zwischen stärkeren und schwächeren Schülern, wenn sich der Unterricht durch wenig Lehrerlenkung und wenig Strukturierung auszeichnet, eher weitet. (…) Geöffnete Unterrichtsformen laufen demnach Gefahr, insbesondere die Schüler mit geringeren Vorkenntnissen zu benachteiligen, da die Komplexität der behandelten Probleme und Aufgaben das Arbeitsgedächtnis der Schüler zu stark belastet und damit das Lernen und Verstehen neuer Inhalte erschwert. (…) (S. 167f)
Alfieri, Brooks, Aldrich und Tenenbaum (2011) verglichen in ihrer Metaanalyse zunächst die Wirksamkeit entdeckenden Lernens mit geringer Lehrerlenkung mit der Wirksamkeit lehrergelenkter Unterrichtsverfahren (Direkte Instruktion). Den Ergebnissen zufolge fallen die Leistungen von Schülern beim entdeckenden Lernen mit nur geringer Lehrerlenkung geringer aus (d = -0.38) als im Rahmen von lehrergelenkten Unterrichtsverfahren (Direkte Instruktion). Das Bild dreht sich jedoch um, wenn man entdeckendes Lernen mit einer stärkeren Lehrerlenkung und Strukturierung mit anderen Unterrichtsformen vergleicht. Dann wird aus der negativen Effektstärke von d = -0.38 eine positive von d = 0.30, was bedeutet, dass die Schüler in einem Unterricht, der entdeckendes Lernen mit gleichzeitiger Lehrerlenkung und -strukturierung realisiert, mehr lernen als in anderen Unterrichtsformen (Alfieri u. a. 2011). Hierzu passen auch weitere Detailergebnisse der Studie von Alfieri und Kollegen (2011): Sie zeigten nämlich, dass entdeckendes Lernen dann wirksamer ist und höhere Effektstärken erzielt, wenn der Unterrichtsstoff klar strukturiert ist, wenn die Schüler aufgefordert werden, die erarbeiteten Sachverhalte und Lösungswege sich oder Mitschülern zu erklären, wenn die Lernenden Feedback erhalten und wenn ihnen Lösungsbeispiele angeboten werden (Alfieri u. a. 2011).
Die Studie von Hardy, Jonen, Möller und Stern (2006) verglich ebenfalls die Wirksamkeit zweier unterschiedlich strukturierter Lernumgebungen. Inhaltlich ging es in dieser Studie um naturwissenschaftliches Lernen im Grundschulunterricht, genauer um Schwimmen und Sinken. Die Lernumgebung mit der stärkeren Strukturierung (high instructional support) zeichnete sich u. a. durch eine stärkere Sequenzierung der Lernangebote sowie durch eine stärkere Beschränkung und Fokussierung der Lernmaterialien aus. Hinzu kam, dass die Lehrperson häufiger strukturierende inhaltliche Hilfen und Hinweise gab, um die Lernenden zu unterstützen und den Konzeptaufbau und -wechsel der Lernenden zu fördern. In der Lernumgebung mit der geringeren Strukturierung (low instructional support) hielt sich die Lehrperson dagegen mit strukturierenden Hinweisen deutlich zurück. Außerdem zeichnete sich diese Lernumgebung dadurch aus, dass die Lernangebote nicht in einer bestimmten Reihenfolge bearbeitet werden mussten, sondern den Schülern ein offenes Materialangebot zur Verfügung stand. Die Ergebnisse der Unterrichtseinheit zeigten, dass die Schüler in der geöffneten und gleichzeitig strukturierten Lernumgebung (high instructional support) mehr lernten und weniger Misskonzepte entwickelten als in der Lernumgebung mit dem geringeren Maß an Strukturierung und dem höheren Grad an inhaltlichen Wahlfreiheiten (low instructional support). Diese Studie unterstreicht demnach, dass eine Öffnung des Unterrichts offenbar dann positive Wirkungen auf den Aufbau bzw. den Erwerb naturwissenschaftlicher Konzepte hat, wenn sie mit einer fachlich begründeten Sequenzierung des Inhalts und mit einer kognitiven Strukturierung durch die Lehrperson einhergeht.
Was bedeutet kognitive Strukturierung in diesem Zusammenhang? Strukturierung in dem hier verstandenen Sinne bedeutet primär nicht, den Unterricht in einzelne Abschnitte oder Phasen zu gliedern. Sicher ist diese Form der Gliederung auch wichtig. Kognitive Strukturierung in dem hier verstandenen Sinne bedeutet vielmehr, dass die Lehrperson z. B. durch Fragen, Hinweise oder Verweise die Aufmerksamkeit der Lernenden auf ausgewählte Aspekte des Unterrichtsgegenstands lenkt, auf Wichtiges hinweist und durch Impulse und Hinweise anregt, Zusammenhänge zwischen bisher Gelerntem und neuen Teilinhalten zu erkennen und damit die kognitive Einordnung der Erfahrungen, die die Lernenden sammeln, ermöglicht (Einsiedler & Hardy 2010; Lipowsky 2015). (S.173f)
(…) Galton, Simon und Croll (1980) [berichten] bereits im Rahmen der britischen ORACLE-Studien, dass Lehrpersonen in geöffneten Unterrichtsphasen nur selten inhaltliche Impulse geben und sich stattdessen weitgehend darauf konzentrieren, Arbeitsaufträge zu erläutern und die Erledigung der Arbeiten zu kontrollieren. Das Arbeiten der Schüler zeichnet sich eher durch ein Nebeneinander statt ein Miteinander aus, die Lernangebote bestehen in der Regel aus kleinschrittig aufgebauten Aufgabenfolgen, die kaum zum entdeckenden Lernen anregen. Im lehrergesteuerten Unterricht, den die Forscher im Rahmen der ORACLE-Studien ebenfalls beobachteten, zeigt sich demgegenüber ein höheres Anregungsniveau der durch die Lehrpersonen initiierten Aufgabenstellungen (zsf. Lipowsky 1999c).
Auch deutsche Studien kommen zu ähnlichen Befunden. Unterrichtsbeobachtungen legen den Schluss nahe, dass es den Lehrpersonen im geöffneten Unterricht eher um die Erfüllung von Arbeits- und Wochenplänen geht als um die inhaltliche Unterstützung und um die Anregung der Lernenden zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand (Huf & Breidenstein 2009). Nicht die Schüler, sondern Materialien und Pläne übernehmen stattdessen die Steuerung der Lernprozesse, welche in Verbindung mit ritualisierten Formen der Steuerung zumindest für einige Schüler mit eher geringen kognitiven Anforderungen und mit Langeweile einhergehen (Breidenstein 2014). (S. 175f)
In der Wissenschaft wird daher durchaus kontrovers darüber diskutiert, ob es überhaupt realistisch und angemessen ist, den Begriff der Individualisierung für Unterrichtsprozesse zu verwenden. Arnold und Richert (2008) geben zu bedenken, dass Lehrpersonen – realistisch betrachtet – in der Lage sein dürften, drei bis vier, aber nicht 20 bis 25 unterschiedliche Lernangebote zu unterbreiten. (…) Lehrpersonen und Schüler würden gleichermaßen überfordert, wenn man den Anspruch erhebt, unterrichtliche Angebote an einzelne Schüler anpassen zu wollen. Tatsächlich lässt sich annehmen, dass die Organisation und die Steuerung einer so hohen Anzahl unterschiedlicher Prozesse bereits so viele kognitive Kapazitäten der Lehrperson beanspruchen, dass für eine anspruchsvollere inhaltliche Unterstützung keine freien Kapazitäten mehr zur Verfügung stehen. (S. 178f)
(…) Die Qualität kooperativer Lernprozesse bemisst sich daran, ob die Lernenden sich wirklich inhaltlich austauschen, also unterschiedliche Argumente entwickeln und diese wechselseitig prüfen, aufeinander Bezug nehmen, eigene Unklarheiten bemerken und zur Sprache bringen und in der Lage sind, geeignete Rückfragen zu stellen. Die Forschung zum kooperativen Lernen zeigt, dass ein so verstandenes transaktives Interaktionsverhalten der Schüler und die vertiefte soziale Auseinandersetzung der Lernenden untereinander wesentliche Merkmale für erfolgreiches Lernen darstellen (Jurkowski & Hänze 2010, Lipowsky 2015, Scherer & Moser-Opitz 2010). (S. 180f)
Aber nicht nur die Arbeit mit Partnern oder in Kleingruppen hat im Unterricht ihre Berechtigung, sondern auch Unterrichtsgespräche mit der gesamten Klasse [siehe dazu auch den Beitrag auf der web-Seite des Schulforum-Berlin, „Pädagogische Beziehung und Klassengemeinschaft“, Jochen Krautz] haben ihre Bedeutung, denn im Unterschied zum individuellen Lernen und zum Lernen in Gruppen ist hier – bei einer entsprechend produktiven Umsetzung – das erwartbare Spektrum an Meinungen, Ideen und Argumenten, welche zu einer Weiterentwicklung kognitiver Strukturen und damit zum Weiterlernen beitragen können, noch größer. Schüler können auch von den Ideen, Beiträgen und Argumenten anderer profitieren, selbst wenn sie »nur« zuhören (vgl. Mayer 2004). Produktive Unterrichtsgespräche erfordern unter anderem, dass sich die Lehrperson im Vorfeld überlegt, wo die Schüler stehen, welche erwartbaren Lernschwierigkeiten oder Fragen auftreten könnten, dass sie selbst gute und anregende Fragen stellt, welche die Lernenden dazu anregen, zu argumentieren, ihre Gedankengänge offen zu legen und über ihren Lernprozess zu reflektieren, dass sie ausreichend Wartezeiten lässt, dass sich das Gespräch um relevante fachliche Kernideen oder Inhalte dreht und dass die Lehrperson durch ihre Gesprächsführung dazu beiträgt, dass sich die Schüler bei der Entwicklung von Ideen und dem Erläutern eigener Meinungen aufeinander beziehen (zsf. Lipowsky 2015, Pauli 2010). Inwiefern ein hochgradig individualisierter Unterricht die oben beschriebenen ko-konstruktiven Prozesse auslösen kann, ist fraglich. Lernende vor die Aufgabe zu stellen, sich ein Thema eigenständig unter Heranziehung zur Verfügung stehender Medien und unter freier Zeiteinteilung zu erarbeiten, impliziert nicht schon automatisch kognitive Herausforderungen und regt nicht schon zwingend zur Argumentation und zur Aktivierung von Vorwissen an, welche für das Lernen aus kognitiv-konstruktivistischer Sicht wichtig sind. (S. 182)
In den vorherigen Abschnitten wurde bereits auf Studienergebnisse aufmerksam gemacht, nach denen die inhaltliche Qualität eines stark individualisierenden Unterrichts in vielen Fällen eher gering ausfällt. Daher erscheint es geboten, die Tiefenstruktur des Unterrichts genauer in den Blick zu nehmen. Mit der Tiefenstruktur des Unterrichts sind Strategien und Maßnahmen der Lehrperson gemeint, welche die Verarbeitung und das Verstehen der Inhalte durch die Schüler befördern. Hierzu zählen z. B.
• fachliche Erklärungen der Lehrperson,
• Anregungen zur Metareflexion und zum Aufbau und zur Nutzung von fachbezogenen Lernstrategien,
• Maßnahmen zur Aktivierung des Vorwissens der Schüler,
• Maßnahmen, die die kognitive Strukturierung und Verarbeitung von neuen Lerninhalten erleichtern,
• die fachliche Kohärenz [Zusammenhang] des Unterrichts und
• die fachliche Korrektheit der Lehreräußerungen.
Entsprechend können als Ausdruck einer kognitiven Aktivierung der Lernenden unter anderem folgende Schüleraktivitäten verstanden werden:
• das Begründen von Antworten,
• die Erläuterung und Erklärung von Lösungswegen,
• der Vergleich und die Bewertung von Lösungsverfahren,
• das Stellen eigener inhaltlicher Fragen,
• die Formulierung von Annahmen,
• das Identifizieren von Gemeinsamkeiten und Unterschieden infolge vergleichender
Analysen,
• das Hinterfragen von Antworten,
• die Bezugnahme auf das eigene Vorwissen und auf die Antworten von Mitschülern sowie
• das Vergleichen von Annahmen und Beobachtungen/Ergebnissen von Experimenten. (S. 192)
Damit sind u. a. Merkmale wie die inhaltliche Klarheit und Kohärenz des Unterrichts, die kognitive Aktivierung, die metakognitive Förderung, die lernstrategische Unterstützung sowie konstruktives Lehrerfeedback umschrieben (vgl. z. B. Lipowsky 2015, Lotz & Lipowsky in diesem Band).
Der Begriff der kognitiven Aktivierung wird zwar sehr unterschiedlich breit definiert, umschreibt aber im Kern einen Unterricht, der die Lernenden zum Nachdenken und zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsthema anregt (z. B. Lipowsky 2015, Klieme, Schümer & Knoll 2001).
Fazit: (…) Adaptive Unterrichtskonzepte und -strategien von Lehrpersonen, welche sich an den Voraussetzungen und Bedürfnissen von Lernenden orientieren und demzufolge Formen von differenzieller Unterstützung und Anregung beinhalten, sind angesichts der wachsenden Heterogenität in deutschen Klassenzimmern zunehmend relevant. Hieraus wird häufig die Schlussfolgerung abgeleitet, dass Unterricht weitgehende Individualisierungen ermöglichen müsse. (…) Eine extreme und weitgehende Individualisierung erscheint nicht als Problemlösung der Wahl. Eine solche Individualisierung läuft – dies machen die empirischen Befunde deutlich – zum einen Gefahr, dass Schüler – insbesondere diejenigen Schüler mit schwächeren und ungünstigeren Voraussetzungen – nicht angemessen gefördert werden. Zum anderen ist zu beachten, dass sich fruchtbare und vertiefte Lernprozesse häufig in sozialen Kontexten und in der Auseinandersetzung mit Ideen und Anregungen von Mitschülern und anderen Bezugspersonen, wie Lehrpersonen oder Eltern vollziehen. Eine sehr weitreichende Individualisierung verkennt das Potenzial sozialer Kontexte beim Lernen. (…) (S. 206)
