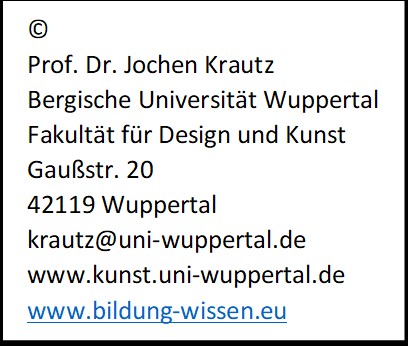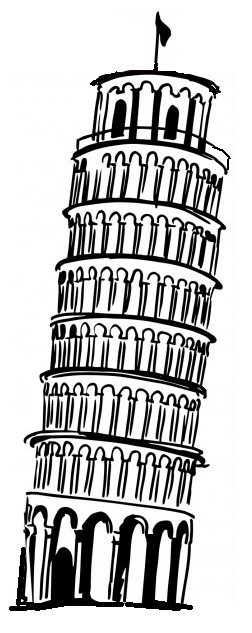Die postulierte digitale Bildungsrevolution frisst ihre Kinder und Familien.
Warum digitales Lernen auch in Krisenzeiten nur ein Notstopfen bleibt.
Jochen Krautz
Prof. Dr. Jochen Krautz lehrt Kunstpädagogik an der Bergischen Univesität Wuppertal und ist Präsident der Gesellschaft für Bildung und Wissen.
Krisenzeiten sind Zeiten, in denen interessierte Kreise gerne versuchen, aus der Not Profit zu schlagen. Dieser Profit kann materieller oder ideologischer Natur sein. Im Falle der Corona-Krise gerieren sich die bekannten Befürworter der „Digitalisierung von Bildung“ als solche ideologischen und materiellen Krisengewinnler. Nun scheint endlich bewiesen, wie dringlich die Umstellung von Schule und Hochschule auf digital gestütztes Lehren und Lernen sei. Und seitens der Politik entblödet man sich nicht, dies auch noch zu forcieren.
Corona-Krise als Change-Instrument für Digitalisierung
So äußerte die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, die selbst keine eigene Fachexpertise in beiden Bereichen nachweisen kann, auf die Frage, ob sich nun räche, „dass wir die Digitalisierung an den Schulen verschlafen haben?“: „Die Corona-Krise bietet Deutschland in Sachen digitaler Bildung eine große Chance: Wir können einen echten Mentalitätswandel schaffen. Wir sehen, wie nützlich digitale Lernangebote sein können. Alle sind jetzt bereit, es einfach mal auszuprobieren. Ich sehe eine neue Aufbruchsstimmung. (…) Aber auch nach der Krise muss die Digitalisierung der Schulen energischer vorangetrieben werden.“[1] Damit macht sie deutlich, worum es geht: Die Krise soll als Instrument genutzt werden, um Mentalität, also Einstellungen, Werte und Überzeugungen aufzuweichen und für den „Wandel“ zu öffnen. Dazu soll Euphorie erzeugt werden, die dann auch nach der Krise aufrechtzuerhalten und zu perpetuieren sei.
Damit referiert Karliczek lupenrein den Dreischritt des Change-Managements: Um Menschen manipulativ in ihren Überzeugungen zu verändern, erzeugt oder nutzt man eine Schocksituation, der eine Verunsicherung in den eigenen Überzeugungen bewirkt (unfreezing). Darauf forcieren Change-Agenten die Euphorie für das Neue, betonen dessen Alternativlosigkeit und geißeln alle Kritiker als rückständige Bedenkenträger (moving). Und schließlich soll der „Wandel“ verstetigt werden, so dass es keinen Weg dahinter zurück zu geben scheint (refreezing).[2] Die darin liegende antidemokratische Anmaßung wird der Ministerin kaum bewusst sein, da sie doch eher Diskurse reproduziert, von denen sie selbst beständig bombardiert wird. So etwa auch von „Mr. PISA“ Andreas Schleicher, der mit maoistisch-kulturrevolutionärer Rhetorik glänzt: „Das Land kann beim digitalen Lernen jetzt einen Riesensprung nach vorn machen.“[3]
Was das Arbeitsblatt nicht kann und die Eltern überfordert
Doch selbst Herr Schleicher gesteht gleich darauf ein: „Schule im Homeoffice (ist) dauerhaft keine gute Idee. Lernen ist ein Prozess, der viel mit der Beziehung von Lehrern und Schülern zu tun hat. Und für diese Beziehung braucht es echten Kontakt.“
Aber auch das ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Warum also braucht Lernen – und wir präzisieren – bildendes Lernen Schule und Unterricht in Realpräsenz? Warum sind Eltern damit auf Dauer grundsätzlich überfordert?[4] Und warum können dies auch Lehrerinnen und Lehrer beim besten Willen nicht über digitale Kommunikation leisten und Lernprogramme entsprechender Konzerne erst recht nicht?
Das liegt in der Natur des Arbeitsblattes, das per Mail als pdf ins Haus kommt, der im Chat kommunizierten Aufgabe, der im Download von Verlagen (generös kostenlos) verfügbaren Selbstlernmaterialien und auch avancierter interaktiver Lernprogramme. Sie alle können wie deren Vorläufer im „programmierten Lernen“ der 1970er Jahre nur schrittige Anweisungen geben, die aber keinen interpersonalen Dialog und keine empathische Resonanz ermöglichen. Die Techniken können so tun als ob und ein „Feedback“ vorsehen, das aber nicht auf die Verstehensvorgänge des einzelnen Schülers Bezug nehmen kann. Arbeitsmaterialien solcher Art sind also zunächst materialisierter Frontalunterricht der schlechten Art, wie man ihn dem Klassenunterricht der Schule gerne und zu Unrecht unterstellt: Hier wird doziert, auswendig gelernt, ggf. geübt und abgefragt. „Lernen“ heißt hier Informationsentnahme, -verarbeitung und ggf. -anwendung.
Mit nun auftretenden tatsächlichen Verstehensproblemen wenden sich die Kinder an ihre Eltern. Diese sind jedoch mit der Unterstützung schnell überfordert, weil ihnen die fachliche, didaktische und pädagogische Expertise fehlt, auf die Verstehensprobleme ihrer Kinder sachadäquat und altersgerecht einzugehen. Denn dazu müsste man das fachliche Problem nicht nur selbst beherrschen, sondern in seiner Problemstruktur verstanden haben, um es didaktisch auf die notwendigen fachlichen Voraussetzungen und Problemlagen analysieren zu können; man müsste Wege des fachlichen Verständnisses und auch Missverstehens kennen, deren mögliche Gründe einschätzen können und beim Kind mit Blick auf bisher Gearbeitetes und durch Gespräche eruieren, welchen fachlichen Grund eine Schwierigkeit hat. Zugleich müsste man die individuelle Lernhaltung des Kindes, den persönlichen Hintergrund und seine Lerngeschichte in diesem und anderen Fächern einschätzen, um dann sowohl fachlich wie didaktisch und pädagogisch angemessenen reagieren zu können.
All das können Eltern gewöhnlich nicht – und sie müssen es auch nicht können. Dafür sind Lehrerinnen und Lehrer da, dafür gibt es Schule und Unterricht. Dafür absolvieren Lehrkräfte ein langes Fachstudium, dafür erwerben sie pädagogische Expertise, dazu sammeln sie reflektierte Erfahrung in diesen Situationen, und deshalb können sie nach Jahren solche Prozesse im laufenden Unterrichtsgeschehen einer ganzen Klasse in Sekunden erfassen, abwägen, entscheiden und umsetzen. Eben das macht Unterrichten so anspruchsvoll und mitunter anstrengend – noch vor allen sonstigen Herausforderungen. Und zugleich ist das für die allermeisten Lehrerinnen und Lehrer der eigentliche Grund ihres pädagogischen Engagements.
Legen wir nochmals den ambitionierten Wochenplan mit Arbeitsblättern, Lösungs- und Reflexionsbögen sowie Lerntagebuch und Leistungsportfolio daneben: Kinder sollen all das nun alleine leisten? Arbeitsblätter sollen dialogisch auf ihr Verstehen und Nichtverstehen eingehen? Feedbackbögen sollen ermutigen, ermahnen, Verständnis zeigen, mit Klarheit oder Humor zurück zur Sache leiten? Videochats sollen das gemeinsame und dialogische Hören, Sehen, Vorstellen, Überlegen, Nachdenken, Ideenfinden und –verwerfen in einer realen Klassengemeinschaft ersetzen? Das wird auch keine K.I. in Gestalt von Lehrrobotern jemals können.
Doch Eltern bemerken schmerzhaft, dass nun erstmalig die postulierte digitale Bildungsrevolution ihre Kinder und Familien frisst. Auch der „große Sprung nach vorn“ des großen Vorsitzenden endete in der Zerschlagung von kultureller Tradition, in der Entwurzelung von Millionen Menschen und einem ökonomischen Desaster. Brauchen wir das erneut im Gewand des schicken iPads?
Unterricht muss Verstehen anleiten
Die Schule ist deshalb ein geeigneterer Ort für die formulierten Aufgaben, weil im guten Falle der Unterricht die Sache in sozialer Gemeinschaft erschließt.[5] Unterricht, der auf Bildung zielt, versucht mit didaktischen und pädagogischen Mitteln, die Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Verstehen einer Sache anzuleiten.[6] Selbstständiges Verstehen ist aber nicht gleichzusetzen mit der vermeintlich selbstständigen Erledigung von wie digital auch immer übermittelten Arbeitsaufträgen oder gegoogelten Informationen. Damit ist die Sache noch nicht erschlossen, d.h. in ihren Gründen verstanden: Entscheidend ist nicht nur, dass eine mathematische Rechnung richtig ist, sondern warum sie das ist. Die Inhaltsangabe einer Fabel ist nur Voraussetzung, um ihren Gehalt zu interpretieren. Ein historisches Datum sagt noch nichts über dessen Bedeutung für uns heute. Ein biologisches Faktum zu benennen, heißt noch nicht seine Relevanz für Mensch, Tier, Welt und Wissenschaft verstanden zu haben. Und ein Kunstwerk zu beschreiben, sagt noch nichts über dessen historischen und gegenwärtigen Sinn.
Verstehen meint also Sinnverstehen. Sinn meint dabei den Sinn der Sache und den Sinn für uns, die Lernenden. Was geht uns das an? Was bedeutet uns das? Erst dann kann Lernen bildend wirken. Und erst dann löst Schule den in den Verfassungen als Bildungsauftrag verankerten Anspruch der Aufklärung ein, dass junge Menschen lernen sollen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, also Selbsterkenntnis und Urteilskraft erwerben, und dass sie Werte wie Mitmenschlichkeit, Achtung und Friedfertigkeit als Haltungen ausbilden und begründen können – mit einem Wort: dass sie mündig werden.
Daher operieren Digitalisierungsbefürworter immer mit einem ungeklärten und reduktionistischen Lernbegriff, denn „digitales Lernen“ kann immer nur die Schrumpfform dieses Anspruchs sein. Es läuft letztlich darauf heraus, aufgrund von Reiz und Reaktion Informationen zu beschaffen, auszuwerten, zusammenzustellen, anzuwenden und/oder auswendig zu lernen. Das sind alles unverzichtbare und legitime Teilprozesse schulischen Lernens. Aber eben nur der notwendige Teil, um verantwortliche Selbstständigkeit im Denken und Urteilen, im Sagen und Handeln zu bilden. Dies aber ist per digitalen Medien nicht erreichbar. Auch wenn man diesen Reduktionismus nachsichtig dem Marketingeifer der Digitalbegeisterten zuschreiben mag, so ist er doch unpädagogisch, antiaufklärerisch und widerspricht dem Bildungsauftrag der Verfassungen.
Schule ist ein sozialer Raum
Die besondere Qualität solchen Verstehens ist dabei gebunden an das soziale Miteinander von leibhaftigen Personen. Es kann sich nur bilden, wenn sich Menschen wechselseitig wahrnehmen, wenn eine Klassengemeinschaft an einer Sache gemeinsam arbeitet, wenn Ideen entstehen, geäußert, diskutiert, begründet oder verworfen werden, wenn gezeigt, erklärt, mit Händen und Füßen vorgemacht und veranschaulicht wird, wenn zugleich gestritten und versöhnt wird, wenn Auseinandersetzungen geklärt, ein sozial konstruktiver Umgang angeleitet und die Klassengemeinschaft zu Kooperation, gegenseitiger Hilfe und Friedfertigkeit angeleitet wird. Kurz: Wenn im Vollsinne unterrichtet wird.[7]
Denn Unterricht bedeutet im Kern das Teilen und Mitteilen von Vorstellungen einer Sache.[8] Lehrerinnen und Lehrer bemühen sich mit all den Mitteln, dass Schülerinnen und Schüler eine sachgemäße, aber doch immer auch individuell geprägte Vorstellung eines Sachverhalts bilden. Sie versuchen, diese Vorstellungsbildungen der Schüler zu verstehen, greifen sie auf, entwickeln sie weiter, leiten den Austausch der Schülerinnen und Schüler untereinander an und führen das gemeinsame Denken wieder zielführend zusammen, um gemeinsame Erkenntnisse zu formulieren. Insofern ist der Klassenraum ein Raum gemeinsam geteilter Vorstellung, in dem sich die Personen dialogisch miteinander und mit der Sache verbinden. Ja, in gewisser Weise entsteht ein Atommodell in Chemie, eine Raumvorstellung in Geografie, eine Formel in Mathematik oder eine Harmonie in Musik erst in und durch die gemeinsame Vorstellungsleistung. Darin wird Kultur konkret lebendig und von den Schülerinnen und Schülern je individuell reformuliert. Unterricht ist also – bei allem, was man aus soziologischer Sicht ansonsten über die Gründe und Probleme von Schule anführen mag – der spezielle Ort, an dem Menschen ihr kulturelles Leben weitergeben und neu befruchten. Diese spezifische Qualität des Klassenunterrichts kann ein isoliert zu bearbeitender Wochenplan und das digital vereinzelte Arbeiten prinzipiell niemals einholen. Dies spricht nicht gegen sachlich begründetes zeitweises Arbeiten in individuellen Lernformen oder mit digitalen Arbeitsmitteln – aber für deren sekundäre Bedeutung und v.a. gegen deren Verabsolutierung.
In dieser Hinsicht ist so verstandener Unterricht in sozialer Bezogenheit zudem immer auch ein Ort sozialen Ausgleichs, denn er spricht alle jungen Menschen gleichermaßen als lernfähige und bildsame Personen an. Daher ist aus pädagogisch-anthropologischer, lerntheoretischer und inzwischen auch empirischer Sicht klar, dass die Isolierung von Schülerinnen und Schülern in atomisierten Lernsettings die soziale Spaltung forciert. Darauf hat Hermann Giesecke schon früh hingewiesen:
„Nahezu alles, was die moderne Schulpädagogik für fortschrittlich hält, benachteiligt die Kinder aus bildungsfernem Milieu. Sozial selektiert wird bereits mit dem ersten Schultag. ‚Offener Unterricht‘, überhaupt die Demontage des klassischen, lehrerbezogenen Unterrichts, die Wende vom Lehren zum Lernen und damit die übertriebene Subjektorientierung, die Verunklarung der Leistungsansprüche, Großzügigkeit bei der Beurteilung von Rechtschreibschwächen (…) hindern die Kinder mit von Hause aus geringem kulturellen Kapital daran, ihre Mängel auszugleichen, während sie den anderen kaum schaden. (…) Das einzige Kapital, das diese Kinder (Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien) von sich aus – ohne Hilfe ihres Milieus – vermehren können, sind ihr Wissen und ihre Manieren; dafür brauchen sie eine Schule, in der der Lehrer nicht nur ‚Moderator‘ für ‚selbstbestimmte Lernprozesse‘ ist, sondern die Führung übernimmt und die entsprechenden Orientierungen vorgibt. Gerade das sozial benachteiligte Kind bedarf, um sich aus diesem Status zu befreien, eines geradezu altmodischen, direkt angeleiteten, aber auch geduldigen und ermutigenden Unterrichts.“[9]
Rückkehr zu Schule und Unterricht
Es ist eine bittere Nebenwirkung des derzeit notfallmäßigen Home-Schoolings, dass dieser Effekt sozialer Spaltung jetzt noch verstärkt werden wird. Daran sind überforderte Eltern in keiner Weise schuld. Umso wichtiger ist aber nach der Rückkehr in den schulischen Normalbetrieb, dass Eltern und Lehrkräfte als Lehre aus der Krise gemeinsam fordern,
- dass nicht mehr, sondern weniger digitalisiert wird,
- dass Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen und Kollegien ihre Unterrichtsformen überdenken,
- dass Universitäten und die zweite Lehrausbildungsphase Nachwuchslehrkräften wieder in die vollständige Kunst zu unterrichten theoretisch und praktisch einführen,
- dass Ministerien den Schulen entsprechende Hinweise geben
- und die Politik jene Digitaladventisten in die Schranken weist, die Corona für ihr Ostern und Pfingsten hielten.
Wenn dann nach der Bewältigung der Krise noch Geld verfügbar ist, das man in den Schulen nicht für dringende Dinge braucht wie etwa Lehrpersonal, Unterstützungsangebote für durch Home-Schooling benachteiligte Schüler, für Bücher, Sporthallen, Kunstwerkstätten, Musikinstrumente, Schulgebäude, funktionierende WCs und dichte Dächer – dann kann man Schule digitaltechnisch auf Grundlage von Open-Source-Lösungen und abgekoppelt vom Internet [10] sowie mit Stellen für Systemadministratoren ausstatten und es den Pädagoginnen und Pädagogen überlassen, wie damit pädagogisch, fachlich und didaktisch sinnvoll umzugehen ist. Denn es geht nicht um die Interessen der Hard- und Softwareindustrie, sondern es geht diesmal tatsächlich um die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen.
Dieser Beitrag erscheint mit freundlicher Genehmigung des Autors auf Schulforum-Berlin.
Die Fußnoten zu den Anmerkungen des Autors sind in der PDF-Datei nachzulesen. https://bildung-wissen.eu/wp-content/uploads/2020/04/Krautz-Bildendes-Lernen-braucht-Schule-und-Unterricht-pdf.pdf siehe auch: www.bildung-wissen.eu