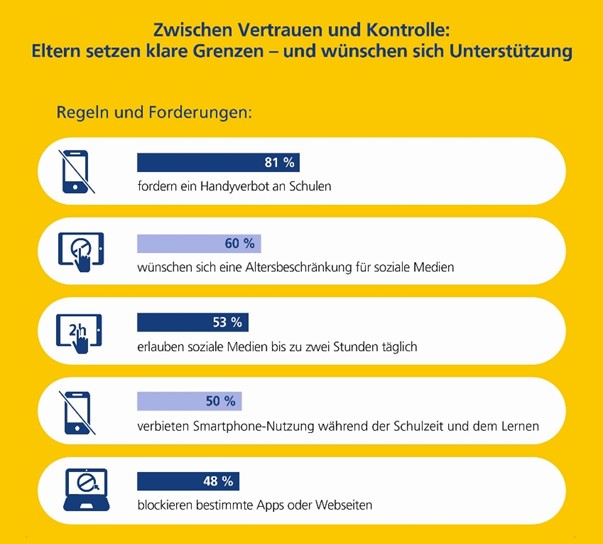John Hattie, 27. Oktober 2025
John Hattie, neuseeländischer Bildungsforscher und Professor an der University of Melbourne in Australien.
Viele Schulen setzen auf individualisiertes, selbstgesteuertes oder personalisiertes Lernen – in der Hoffnung, jedem Kind damit bestmögliche Lernchancen zu eröffnen. Doch der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie warnt: Zu viel Eigensteuerung kann das Lernen eher bremsen als beflügeln. Er plädiert für ein „maßgeschneidertes Lernen“, das auf professioneller Diagnostik und gemeinschaftlichem Lernen basiert.
Das Schulsystem ist durchdrungen von Schlagwörtern und Modebegriffen. Begriffe wie „individualisiertes -“, „personalisiertes -“ oder „selbstgesteuertes Lernen“ sind allgegenwärtig. Sie tauchen in Panel-Diskussionen auf Kongressen, in bildungspolitischen Papieren und Debatten in den sozialen Medien auf.
Obwohl diese Konzepte oft synonym verwendet werden, bezeichnen sie unterschiedliche Ansätze. Beim individualisierten Lernen passen Lehrkräfte Aufgaben an das Leistungsniveau einzelner Schülerinnen und Schüler an. Sie durchlaufen eine auf sie zugeschnittene Aufgabenabfolge in ihrem eigenen Tempo, auch wenn der Lehrplan in der Regel die Ziele vorgibt. Beim personalisierten und selbstgesteuerten Lernen hingegen haben die Lernenden mehr Autonomie: Sie setzen sich eigene Ziele, wählen Lernmaterialien aus und entscheiden, auf welche Weise sie ihre Leistung nachweisen möchten. Diese Ansätze beruhen auf der ansprechenden Idee, dass Lernen von Natur aus individuell sei – dass jedes Kind am besten auf seine eigene Weise lerne.
Diese Ideen sind zweifellos attraktiv. Jedes Kind ist einzigartig, und wir wünschen uns, dass Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihr Lernen übernehmen und es selbst steuern können. Doch trotz der intuitiven Anziehungskraft dieser Ideen müssen wir uns einer unbequemen Wahrheit stellen: Es gibt nur wenig belastbare Forschung, die großflächige Lerngewinne durch so organisierte Lernarrangements zeigt – und viele Studien, die nur minimale Effekte nachweisen. Die vorhandenen Daten weisen auf niedrige oder moderate durchschnittliche Effektstärken hin: 0,03 für schülergesteuertes Lernen und 0,26 für individualisiertes Lernen. Beide liegen deutlich unter der Schwelle von 0,4, die als Grenze für eine bedeutsame Wirksamkeit gilt.
„Das größte Problem von individualisiertem und personalisiertem Lernen liegt in der Überbetonung des Alleinarbeitens.“ John Hattie
Wie steht es also um das personalisierte Lernen? Richtig umgesetzt, kann es ein Gefühl von Eigenverantwortung und Motivation fördern. Schlecht umgesetzt jedoch verkommt es oft zu einer Orientierung an oberflächlichen Auswahlmöglichkeiten – etwa dazu, Unterricht an sogenannte „Lernstile“ anzupassen –, die kaum zu besseren Ergebnissen führen. Auf den ersten Blick deuten Metaanalysen zu personalisiertem Lernen auf eine Effektstärke von etwa 0,46 hin.
Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass dieser vergleichsweise hohe Wert vor allem aus Studien stammt, die Korrelationen statt Kausalzusammenhänge messen. Diese Studien zeigen lediglich, dass Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Lernpräferenzen (zum Beispiel einer Vorliebe für verbale Informationen) tendenziell besser abschneiden – nicht aber, dass die Anpassung des Unterrichts an diese Präferenzen das Lernen tatsächlich verbessert. Berücksichtigt man nur Studien, die den Unterricht auf die Lernstile der Schülerinnen und Schüler abstimmen, sinkt die Effektstärke nahezu auf Null.
Kurz gesagt:
Der Hype um individualisiertes und personalisiertes Lernen übersteigt die Stärke der Forschungsergebnisse bei Weitem. Das Versprechen der Individualisierung ist größtenteils rhetorisch.
Die Gefahr des „Einzellernenden“
Das größte Problem von individualisiertem und personalisiertem Lernen liegt in der Überbetonung des Alleinarbeitens. Der Kern schulischen Lernens war schon immer Zusammenarbeit und soziales Lernen – das Lernen mit und von anderen. Nicht jeder, nicht jede lernt am besten, wenn er oder sie völlig allein entscheidet. Viele Lernende brauchen Struktur, Anleitung und ein gemeinsames Ziel. Wenn Schülerinnen und Schüler hauptsächlich individuell, in ihrem eigenen Tempo und auf ihre eigene Weise lernen, laufen sie Gefahr, zu isolierten „Einzellernenden“ zu werden, anstatt die kollaborativen Fähigkeiten zu entwickeln, die für bedeutsames Lernen entscheidend sind.
Diese Ansätze widersprechen auch gut belegten Forschungsergebnissen zum effektiven Lernen. Lernen lebt von Herausforderung, Feedback und von gemeinsamem Verstehen. Übermäßig individualisiertes Lernen läuft Gefahr, die kognitiven Anforderungen zu senken, weil Schülerinnen und Schüler, wenn sie selbst entscheiden dürfen, dazu neigen, in ihrer Komfortzone zu bleiben. Sie wählen dann Aufgaben, die sie bereits können oder angenehm finden. Schülerinnen und Schüler wissen oft nicht, was sie nicht wissen. Genau deshalb gibt es Lehrkräfte: um ihnen das beizubringen, was sie noch nicht wissen.
„Bildungsgerechtigkeit bedeutet nicht, jedem Kind seinen eigenen Lernpfad zu geben.“ John Hattie
Ein falsches Verständnis von Differenzierung und Bildungsgerechtigkeit
Die Gefahr des Scheiterns von individualisiertem und personalisiertem Lernen liegt demnach in einem grundlegenden Missverständnis von Differenzierung. Kaum eine didaktische Idee wird so häufig fehlinterpretiert. Gute Differenzierung bedeutet nicht, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Aufgaben erhalten. Dieser fehlgeleitete Ansatz im Umgang mit den Unterschieden zwischen Schülerinnen und Schülern ist besonders in Klassenzimmern mit niedrigen Leistungserwartungen weitverbreitet. In solchen Klassen werden Schülerinnen und Schüler nach vermeintlichen Leistungsfähigkeiten gruppiert und erhalten Aufgaben, die als ihrem Niveau „angemessen“ gelten – ein Vorgehen, das, so gut es gemeint sein mag, ihr Lernpotenzial begrenzt.
Die Erwartungen, die wir an Schülerinnen und Schüler haben, haben enorme Auswirkungen auf ihre Lernergebnisse. Die Forschung zeigt: Hohe Erwartungen können die Lernrate von Schülerinnen und Schülern verdoppeln. Lehrkräfte mit hohen Erwartungen differenzieren nicht innerhalb ihrer Erwartungen, sondern beim Weg und bei dem Tempo, um diese zu erreichen. Traurigerweise differenzieren Lehrkräfte mit niedrigen Erwartungen durchaus – und die Auswirkungen auf ihre Schülerinnen und Schüler können verheerend sein.
Ein großes Risiko besteht darin, Personalisierung mit Bildungsgerechtigkeit zu verwechseln. Bildungsgerechtigkeit bedeutet nicht, jedem Kind seinen eigenen Lernpfad zu geben, sondern sicherzustellen, dass jeder Schüler und jede Schülerin mindestens ein Jahr Lernfortschritt in jedem Schuljahr erzielt. In der Praxis können personalisierte Ansätze Ungleichheiten sogar noch verstärken. Denn Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Haushalten landen oft in „individualisierten“ Lernpfaden, die nur begrenzten Zugang zu hochwertigen Unterrichtsgesprächen oder zum Austausch mit leistungsstarken Mitschülerinnen und Mitschüler bieten. Diese Schülerinnen und Schüler arbeiten häufig Arbeitsblätter ganz allein ab, ohne Gelegenheit zu tieferem Lernen, zu Transfer oder kritischem Denken. Echte Bildungsgerechtigkeit würde erfordern, dass Lehrkräfte allen Lernenden – unabhängig von ihrer Herkunft – anspruchsvolle Aufgaben, reichhaltige Dialoge und Aufgaben zumuten, die sie aus ihrer Komfortzone holen.
Vom individualisierten zum maßgeschneiderten Lernen
Anstelle von individualisiertem, selbstgesteuertem oder personalisiertem Lernen schlage ich deshalb einen anderen Ansatz vor – ich nenne ihn „maßgeschneidertes Lernen“. Maßgeschneidertes Lernen bedeutet eben nicht, jedem Kind ein eigenes Curriculum zu geben oder den Lernenden die Kontrolle über ihr Lernen zu geben. Vielmehr bedeutet es, dass Lehrkräfte ihren Unterricht basierend auf dem Lernfortschritt jedes einzelnen Schülers, jeder einzelnen Schülerin gezielt anpassen.
Schulen passen Unterricht, Ressourcen und Leistungsüberprüfungen an bestimmte Gruppen, Kontexte oder Individuen an – etwa durch temporäre Einzel- oder Kleingruppenförderung (ohne dabei Kinder abzustempeln oder dauerhaft abzusondern). Maßgeschneidertes Lernen wiederum verlangt von Lehrkräften, Lernstände zu diagnostizieren, Feedback zu geben und den Schwierigkeitsgrad anzupassen, sodass jeder Schüler und jede Schülerin angemessen herausgefordert werden. Gleichzeitig setzt maßgeschneidertes Lernen auf die Kraft der Gemeinschaft: Schülerinnen und Schüler lernen in erheblichem Maße voneinander – im Guten wie im Schlechten. Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass sie auf die richtige Weise voneinander lernen.
Maßgeschneidertes Lernen beruht daher auf der professionellen Expertise und dem Urteil der Lehrkräfte. Die Klarheit einer Lehrkraft hat beispielsweise einen mehr als doppelt so starken Einfluss auf die Lernergebnisse wie eine oberflächliche Personalisierung im Unterricht. Statt Hypes nachzujagen, sollte sich das professionelle Lernen von Lehrkräften auf die Klärung von Lernzielen, Erfolgskriterien und Feedback richten – und sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler diese hören, verstehen und danach handeln. Natürlich müssen Schülerinnen und Schüler ebenfalls lernen, Verantwortung zu übernehmen und sowohl eigenständig zu arbeiten wie auch mit anderen. Aber es gibt eine richtige Zeit für Schülerautonomie – und eine falsche Zeit dafür.
Hervorhebungen durch Schulforum-Berlin
Beitrag als PDF-Datei
Aus: Deutsches Schulportal, https://deutsches-schulportal.de/expertenstimmen/john-hattie-warnt-vor-falsch-verstandener-individualisierung-des-lernens/ (21.10.2025)