Brain Drain: Die bloße Präsenz des eigenen Smartphones reduziert die verfügbare kognitive Kapazität und das Miteinander in der Klasse leidet.
Die nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt in einem im August 2025 veröffentlichten Diskussionspapier[1], die Nutzung von Smartphones in Kitas und Schulen bis einschließlich Klasse 10 zu untersagen.
Smartphones sind die bei Jugendlichen am häufigsten vorhandenen digitalen Endgeräte und daher zentral für die Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche. Studien zeigen, dass ein solches Verbot positive Effekte auf Wohlbefinden, Sozialverhalten und schulische Leistungen haben kann. Die Wissenschaftler plädieren generell für einen Kurs der Vorsicht (Vorsorgeprinzip), solange die Frage, ob es eine ursächliche Beziehung zwischen dem Gebrauch sozialer Medien und der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gibt, noch nicht wirklich geklärt ist.
Im Jahr 2017 kam die „Brain Drain-Studie“[2] zu dem Ergebnis, dass die bloße Anwesenheit eines Smartphones ablenken und kognitive Ressourcen beanspruchen kann. Dieses Ergebnis wurde später durch eine Metaanalyse[3] von 22 Studien bestätigt.
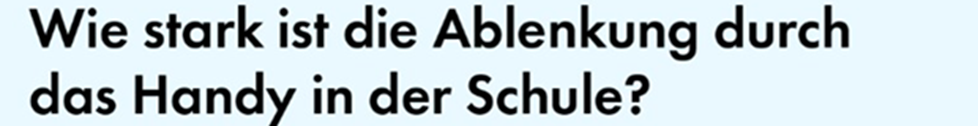
Der Druck, immer erreichbar zu sein ist riesig. Jeder dritte Jugendliche gibt an, nervös zu werden, wenn das Handy nicht in Reichweite ist. Bei den Mädchen sind es sogar 40 Prozent.
Jeder vierte Jugendliche gibt an, die Handy-Benachrichtigungen während des Unterrichts nie oder fast nie auszuschalten – d.h., sie sind ständig online.
Die Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht nicht online sind, schneiden im Schnitt um 19 PISA-Punkte besser als der Durchschnitt ab, was in etwa dem Lernfortschritt eines halben Schuljahres entspricht.

Bild: Deutsches Schulportal
Etwa jeder Vierte gibt an, Druck zu verspüren, während des Unterrichts auf Nachrichten zu antworten. Ähnlich viele geben an, sich durch Mitschülerinnen und Mitschüler, die digitale Geräte nutzen, abgelenkt zu fühlen.
Aufmerksamkeitsökonomie, im Zentrum digitaler Geschäftsmodelle
Kritisch zu sehen ist das Prinzip der Aufmerksamkeitsökonomie, das im Zentrum vieler digitaler Geschäftsmodelle steht, so die nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina[4] in ihrem Diskussionspapier. Die Extraktion und Monetarisierung von Aufmerksamkeit fördert technologische Strategien zur Maximierung der Nutzerbindung und schafft gezielt suchtfördernde Strukturen im digitalen Raum. Die rasante technologische Entwicklung im Digitalsektor befeuert diese ökonomisch motivierte Tendenz noch, weshalb sich die sozialen Medien ebenso rasant weiterentwickeln: Immer leistungsfähigere Algorithmen und KI-Systeme werden eingesetzt, um Nutzerverhalten vorherzusagen und mittels emotionaler Bindung zunehmend zu steuern. KI-basierte, mit Sprachmodellen verbundene Avatare, die automatisierte Simulation zwischenmenschlicher Beziehungen, mit dem Ziel, Vertrauen zu erzeugen und dann maßgeschneiderte Dienstleistungen für spezifische emotionale Bedürfnisse anbieten zu können, sowie die gezielte Erzeugung sogenannter sozialer Halluzinationen eröffnen neue Dimensionen der digitalen Einflussnahme auf Kinder und Jugendliche.
Dr. Tanja Brunnert, Bundespressesprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzt*innen BVKJ e.V.: „Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzt*innen weist seit Jahren auf die Gefahren des zunehmenden und mittlerweile exorbitant hohen Medienkonsums der Kinder und Jugendlichen hin. Wir sehen in unseren Praxen mittlerweile überdurchschnittlich viele Kinder mit Entwicklungsstörungen von Sprache, aber auch Grob- und Feinmotorik. Konzentration und Schlafverhalten leiden. Die Zusammenhänge zum Medienkonsum sind wissenschaftlich nachgewiesen. Die Handreichung zur Handynutzung an Schulen stellt daher einen wichtigen Baustein der Regulierung der ausufernden Mediennutzung dar. Wir begrüßen als Kinder- und Jugendärzt*innen ausdrücklich die Aufforderung, die Grundschulen handyfrei zu gestalten. Vor der Benutzung eines digitalen Endgerätes muss das Kind analog Kompetenzen wie Sprechen, Sprache und Motorik erlangen. Schule muss ein geschützter Raum sein, in dem sich Kinder und Jugendliche sicher bewegen können. Klare Regeln der Schule zur Handynutzung schaffen Verbindlichkeit. Dies schafft zusätzlichen Schutz für Kinder und Jugendliche vor missbräuchlicher Nutzung.“ https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/kultusministerin-hamburg-und-bildungssenatorin-bekeris-prasentieren-regeln-zur-handynutzung-an-schulen-246455.html (22.1.2026)
Regelungen und Pläne zum Handyverbot an Schulen in den Bundesländern[5]
Bildung ist Ländersache, daher regeln die Bundesländer die Frage der Handynutzung an Schulen selbst. Einige haben strenge Regeln und Verbote eingeführt, andere vertrauen auf die Eigenverantwortung der Schulen. Die meiste Zustimmung gibt es dafür, Handys aus Grundschulen zu verbannen.
- In der Stadt Bremen begann das Schuljahr 2025/26 mit einem einheitlichen Handyverbot: An Grundschulen und weiterführenden Schulen bis zur 10. Klasse müssen Handys auf dem Schulgelände ausgeschaltet bleiben. Nach der neuen Regel dürfen Schülerinnen und Schüler ihre Smartphones während des gesamten Schultags nicht benutzen. Wer ein Handy mitbringt, muss es so verstauen, dass es nicht sichtbar ist – etwa in der Schultasche oder einem Schließfach. Ausnahmen vom Handyverbot gibt es zum Beispiel, wenn dieses aus medizinischen Gründen notwendig ist. Ein Ziel des Handyverbots ist, dass Kinder und Jugendliche in den Pausen wieder mehr miteinander im Gespräch sind und sich beschäftigen.
- Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind die Schulen auch 2025/26 selbst für Regeln zur Handynutzung verantwortlich. Insgesamt verfügen nach Angaben des Ministeriums rund 98 Prozent aller öffentlichen Schulen in NRW inzwischen über eine verbindliche Handyregelung, bei den weiterführenden Schulen sind es demnach sogar 100 Prozent. Das zeigt eine landesweite Umfrage, die am 7. Januar 2026 vom Schulministerium veröffentlicht wurde. Etwa die Hälfte aller weiterführenden Schulen in Nordrhein- Westfalen untersagt vollständig die Nutzung von Smartphones im Schulbetrieb. Die andere Hälfte erlaubt eine klar begrenzte Nutzung. Grundsätzlich sollte an Grundschulen die private Nutzung von Handys und Smartwatches nicht erlaubt sein.
- In Sachsen hat Kultusminister Conrad Clemens (CDU) nach einem Handygipfel im August 2025 verkündet, ein Verbot an Grundschulen vorzubereiten. Bisher entscheiden die Schulen selbst. Anfang 2026 solle es bei einem weiteren Fachgespräch um die Nutzung privater Handys an weiterführenden Schulen und Maßnahmen zur Stärkung der Medienkompetenz gehen.
- Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern können 2025/26 weiterhin selbst ihre Regeln zum Umgang mit privaten Smartphones festlegen, haben dazu vom Bildungsministerium aber klare Empfehlungen erhalten. Diese Richtlinien sehen vor, dass in den Klassenstufen eins bis neun während des gesamten Schulbetriebs grundsätzlich keine privaten Handys genutzt werden sollen.
- Länder wie Sachsen-Anhalt, Berlin oder Hamburg verweisen auf die Entscheidungskompetenzen der Schulen. Landesweite Verbote sind nicht geplant.
- Die private Handynutzung ist für Jugendliche an Schleswig-Holsteins Schulen bis einschließlich Klasse 9 ab dem Schuljahr 2025/26 verboten. Das hat das Landesparlament[6] am 18. Juni 2025 beschlossen. Seit 2023 gibt es einen entsprechenden Erlass bereits für Grundschulen.
- In Brandenburg sind mit dem Schuljahr 2025/26 Handys an Grundschulen im Unterricht verboten. Sie müssen während des Unterrichts ausgeschaltet und in Schultaschen, Schränken oder Schließfächern verstaut werden.
- Die Schulen in Niedersachsen und Hamburg sind aufgefordert, binnen eines Jahres verbindliche Regeln zur Nutzung von Smartphones und Smartwatches festzulegen – im Dialog mit den Eltern und Schülern. Die Empfehlung[7] der Behörden lautet klar, keine Handys in der Grundschule zu erlauben. Für die weiterführenden Schulen empfehlen die Expertinnen und Experten einen bewusstseinsbildenden und altersdifferenzierten Umgang mit Smartphones. An den Empfehlungen der beiden Länder haben Kinderärzte, Neurologen, Psychologen, Pädagogen und Medienwissenschaftler mitgewirkt.
- An Thüringens Grundschulen und in der Primarstufe von Förder- und Gemeinschaftsschulen dürfen die Kinder ihre Smartphones nicht mehr privat nutzen. Ein Schreiben mit entsprechenden Vorgaben wurde im August 2025 vom Bildungsministerium an die Schulen verschickt, wie das Ministerium mitteilte. Die Einschränkung der privaten Handynutzung während der Kernschulzeit dient der Konzentration auf den Unterricht, der Förderung der sozialen Interaktion und dem Schutz vor digitalen Überforderungen, erklärte Bildungsminister Christian Tischner (CDU).
- In Hessen ist ab dem Schuljahr 2025/2026 die private Nutzung von Handys in Schulen grundsätzlich verboten. Die Geräte können aber weiter in die Schule mitgenommen werden, etwa für Notfälle, und sie sollen im Unterricht erlaubt bleiben, wenn Lehrer oder Schulen dies gestatten.
- Baden-Württemberg: Künftig müssen sich alle Schulen im Land verbindliche Regeln für den Umgang mit den Geräten geben. Eine entsprechende Änderung des Schulgesetzes hat der Landtag im Dezember 2025 beschlossen. Ein gänzliches Verbot ist möglich.
- In Bayern können sich Schulen oberhalb der Grundschule eine eigene „Nutzungsordnung“ für die private Nutzung von Handys geben, ansonsten gilt grundsätzlich ein Handyverbot. Das Handyverbot an Bayerns Schulen soll verschärfen werden: Smartphones und Mobiltelefone sollen an allen Schulen bis einschließlich der siebten Klasse gesetzlich verboten werden – aktuell gilt ein solch striktes Verbot nur für Grundschulen. Das kündigte Söder am 23.9.2025 auf der Herbstklausur der Landtags-CSU im oberfränkischen Kloster Banz an.
- Im Saarland ist die Benutzung von privaten Smartphones und Smartwatches in den ersten vier Jahrgangsstufen der Grund- und Förderschulen verboten. Das wurde im Juni 2025 vom Landtag beschlossen. Demnach dürfen die Schülerinnen und Schüler zwar Smartphones mit in die Schule bringen, dort aber nicht benutzen.
- Schleswig–Holstein hat ab dem Schuljahr 2025/26 die private Nutzung von Smartphones, Tablets oder Laptops bis zur neunten Klasse in den Schulen verboten. Nach einem Erlass des schleswig-holsteinischen Bildungsministerium sollen alle weiterführenden Schulen Regeln aufstellen, um das Verbot umzusetzen. Dafür haben sie das ganze Schuljahr Zeit.
Immer mehr Bundesländer schränken die Handynutzung in den Schulen ein oder planen weitere Einschränkungen, um die Konzentration sowie die soziale Interaktion im Unterricht zu fördern.
Text- und Bildauswahl sowie Hinweise in den Fußnoten durch Schulforum-Berlin.
Beitrag als PDF-Datei
[1] Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, https://levana.leopoldina.org/servlets/MCRFileNodeServlet/leopoldina_derivate_01077/2025_Leopoldina_Diskussion_40.pdf (22.1.2026)
[2] Brain Drain: Die bloße Präsenz des eigenen Smartphones reduziert die verfügbare kognitive Kapazität, https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/691462 (22.1.2026)
[3] Existiert der Brain Drain-Effekt wirklich? Eine Meta-Analyse, Philosophisch-Sozialwissenschaften Fakultät, Universität Augsburg, https://www.mdpi.com/2076-328X/13/9/751 (22.1.2026)
[4] Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, https://levana.leopoldina.org/servlets/MCRFileNodeServlet/leopoldina_derivate_01077/2025_Leopoldina_Diskussion_40.pdf, S. 46, (22.1.2026)
[5] Handyverbot an Schulen: Diese Regeln gelten in den Bundesländern, Immer mehr Bundesländer setzen auf ein Handyverbot an Schulen – von der Grundschule bis zur neunten Klasse, Stern, 08.09.2025 von Jana Kopp, https://www.stern.de/politik/deutschland/zum-schulstart–in-welchen-bundeslaendern-jetzt-ein-handyverbot-gilt-36037984.html, (22.1.2026)
[6] Schleswig-Holsteinischer Landtag, 18.06.2025 – Juni-Plenum: Ab August: Handy-Verbot an Schulen bis Klasse 9, Zu viel Ablenkung und eine behinderte soziale Interaktion, https://www.landtag.ltsh.de/nachrichten/25_06_17_smartphones_schule_nutzung/ (22.1.2026)
[7] Kultusministerin Hamburg und Bildungssenatorin Bekeris präsentieren Regeln zur Handynutzung an Schulen: „Unser gemeinsames Anliegen ist es, den Schulen klare Leitplanken und Orientierung im Umgang mit privaten digitalen Endgeräten zu bieten“. https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/kultusministerin-hamburg-und-bildungssenatorin-bekeris-prasentieren-regeln-zur-handynutzung-an-schulen-246455.html (22.1.2026)
Die Grundlinie ist hierbei klar: In Grundschulen wird die Nutzung von Smartphones und Smartwatches ausdrücklich nicht empfohlen. Hamburg erklärt:
„Kein Kind braucht in der Grundschule ein Handy“.


