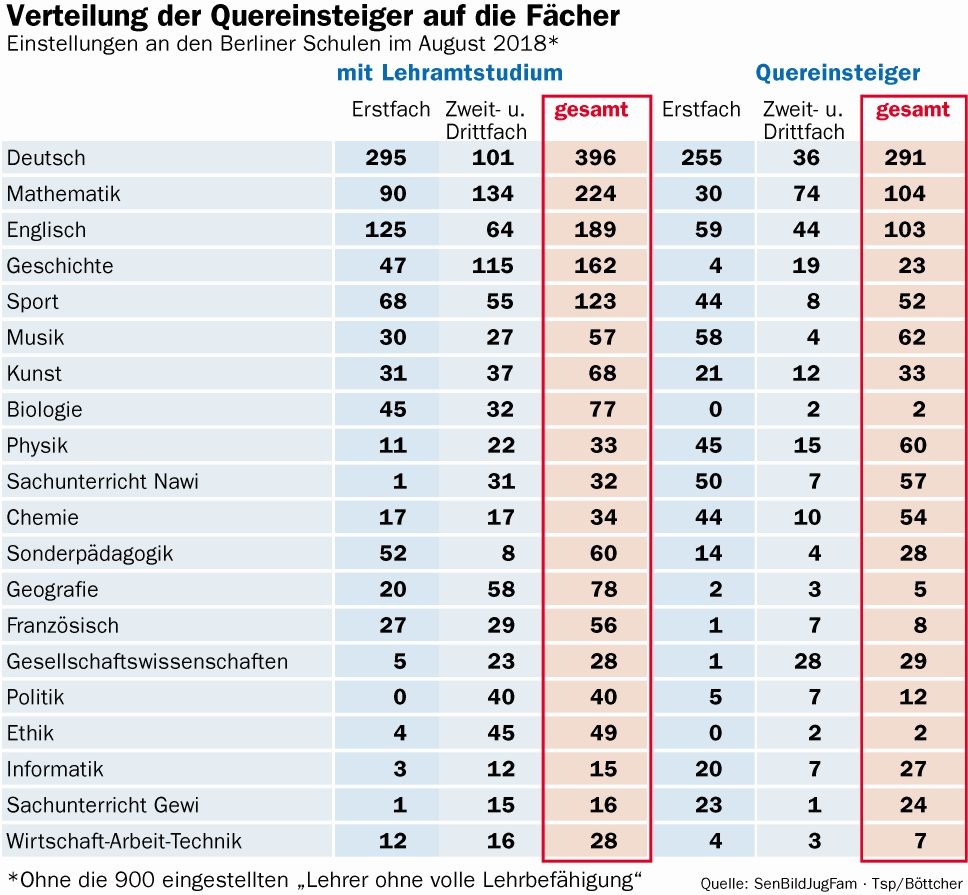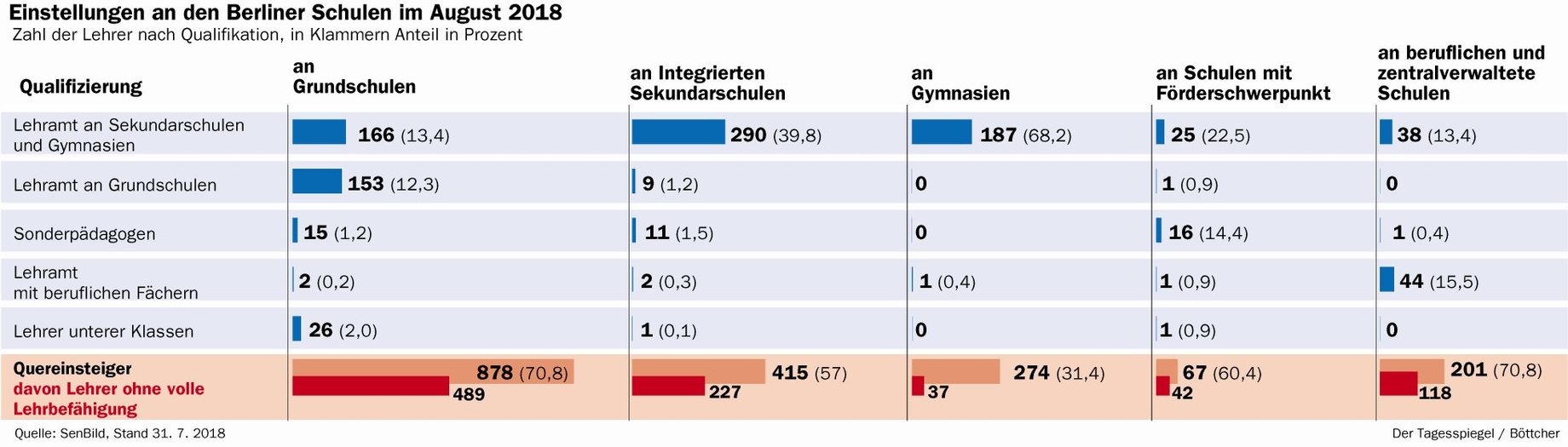Es muss etwas geschehen….
Tagesspiegel, 09.09.2019, von Martin Dorr, Dr. Thomas Gey, Dr. Eva-Maria Kabisch, Annaliese Kirchberg, Christine Sauerbaum-Thieme, Thomas Thieme, Brigitte Thies-Böttcher, Rolf Völzke, Rainer Werner
Zur offensichtlichen Schulmisere in Berlin ist in diesen
Tagen und Wochen bereits viel Richtiges gesagt und öffentlich diskutiert
worden. Da wollen auch wir als Experten aus der Praxis nicht schweigen. Wir
sind engagierte Schulleitungen, Senatsbeamte, Lehrerbildner und Lehrkräfte,
Quereinsteiger und andere Profis aus dem Bildungsbereich, pensioniert oder/und
noch aktiv, die sich seit dem Frühjahr 2019 getreu dem Motto von Heinrich Böll
zusammengefunden haben, um konkrete Vorschläge zur Verbesserung zu erarbeiten
und in den Diskurs mit der Öffentlichkeit und der Senatsverwaltung
einzubringen. Uns eint – trotz unterschiedlicher Positionen im Einzelnen – die
Sorge, ja Fassungslosigkeit über den desaströsen Zustand der Berliner Schule
und damit über das Versagen der Bildungspolitik über Jahre hinweg mit
vorhersehbaren fatalen Ergebnissen. Die lange Liste der Versäumnisse, der
falschen Entscheidungen und aktionistischen Ablenkungsmanöver hat jetzt ein
Ausmaß erreicht, das wir als erfahrene Schulexperten, die seit langem vielfach
auf die sich abzeichnenden Probleme hingewiesen haben, einfach nicht mehr
hinnehmen können. Wir haben unsere Verantwortung nicht mit dem Ruhestand oder
an der Schultür abgegeben – sie bleibt.
Grundsätzliches
Angesichts der neu begründeten „Task-Force“ mit Olaf Köller
befürchten wir weitere endlose Debatten in den mit den bekannten Personen
besetzten Runden, nicht immer mit echter Schulerfahrung, dafür mit
ideologischen Scheuklappen. Diese Einschätzung entspringt einer langen
leidvollen Erfahrung. Stattdessen erscheint uns ein kluger, realitätsnaher
Stufenplan kurzfristig, mittelfristig und langfristig umsetzbarer Maßnahmen
dringend notwendig. Ein überzeugender Zeitplan mit klaren Zielsetzungen, bei
dem die Umsetzung regelmäßig überprüft und ggf. nachjustiert wird, auch und
gerade unter Einbeziehung von Praktikern, ist geboten. Dazu gehören selbstverständlich
objektive Kriterien und der Verzicht auf Schönrednerei.
Im Fokus müssen wieder die Schülerinnen und Schüler und die
Lehrkräfte stehen, nicht zuerst ein ideologisch fixierter Glaube an bestimmte
pädagogische Rezepte, die Befriedigung von Interessenvertretungen, die Sorge um
den politischen Machterhalt oder gar um den eigenen Posten.
Der Schwerpunkt muss angesichts von Abbrecherquoten und
Verfehlung der Mindeststandards auf den Klassenstufen 1-10 liegen. Hier wird
das Fundament für den Erfolg jedweder künftigen Ausbildung gelegt. Dabei
sollten mit einer entsprechenden Konzeption die wichtigen Scharnierstellen in
einer Schülerlaufbahn intensiver in den Blick genommen werden: Die Übergänge
von der Kita zur Grundschule, von der Grundschule zur weiterführenden Schule
sowie in die gymnasiale Oberstufe bzw. die duale Ausbildung. Der Übergang vom
Abitur in den Studienbeginn und die duale Ausbildung insgesamt sollten
einbezogen werden und mehr Beachtung finden im Austausch mit den „Abnehmern“ –
Universitäten und Fachhochschulen sowie ausbildende Unternehmen.
Als Folge davon sollte der Ressortzuschnitt in der
Bildungsverwaltung neu überdacht werden: Angesichts der Situation gehören
Schule, Wissenschaft und berufliche Bildung in ein Ressort.
Inhaltliche Schwerpunkte müssen daher neben dem Schulbau und
der Schulsanierung vor allem Unterrichtsqualität, Lehrpersonal und
Lehrerbildung sowie Verwaltungshandeln/Schulinspektion sein.
An die Stelle des derzeit vorherrschenden reinen Quantitäts-
und Quotendenkens und des trickreichen Umgangs mit Statistiken muss eine
ehrliche und überprüfbare, vor allem inhaltliche Qualitätsverbesserung treten.
Es geht nicht darum, dass „irgendwie“ von „irgendwem“ unterrichtet wird,
sondern um guten, professionellen, nachhaltigen Unterricht.
Wie wäre es außerdem mit einer parallelen Initiative z.B.
durch eine Serie in den Medien, die Berliner Schulstandorte und -konzepte als
Best-Practice-Beispiele in den Blick nimmt, die trotz der großen
Schwierigkeiten erfolgreich gute, lösungs- und leistungsorientierte Arbeit
leisten, kreativ und zukunftsweisend?
Was getan werden muss…
Die nachfolgend genannten Aspekte haben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, schienen in unserer Runde aber vordringlich.
Einiges zur Unterrichtsqualität
Wir fordern, die Qualität des Unterrichts im Kontext von
Lehrer- und Verwaltungshandeln/ Schulinspektion grundlegend zu verbessern. Und
zwar:
Die Wiedereinführung der Vorschule für alle Schülerinnen und
Schüler ist dringlich geboten. Dabei geht es zum einen um den möglichst
angeglichenen Sprachstand in der Unterrichtssprache Deutsch beim Übergang in
die Grundschule, zusätzlich um das Eingewöhnen an und Einüben von wichtigen
Verhaltensweisen, Ritualen und Arbeitsformen. Hier könnten z.B. auch
Quereinsteiger durchaus sinnvoll eingesetzt werden und erste Praxiserfahrungen
vor dem eigentlichen Unterrichten sammeln (in Frankreich hat Präsident Macron
die Erweiterung der école maternelle ab dem Schuljahr 2019/20
verpflichtend gemacht).
Die gegenwärtige Überbewertung unterschiedlichster Methoden,
mehrfachen hektischen Methodenwechsels innerhalb einer Unterrichtsstunde – je
nach tagesaktuellem Mainstream – in der Lehrerbildung geradezu gefordert und
oft ohne wirklichen Bezug zum Unterrichtsthema/Objekt oder zur Situation der
Lerngruppe – wirkt im Hinblick auf die notwendige Übung in Konzentration, der
Möglichkeit von Festigung und Wiederholung des Gelernten sowie
Ergebnissicherung und Überprüfung kontraproduktiv. Die Lerninhalte müssen
wieder Vorrang vor dem methodischen Schaulaufen haben. Schüler müssen am Ende
einer Unterrichtsstunde wissen, worum es gegangen ist und was sie neu gelernt
haben. Nichts gegen kluge methodische Varianten, aber dazu gehört dann auch ein
guter instruktiver Frontalunterricht, der häufig mehr leistet und gerade für
die Schülerinnen und Schüler, die es schwerer haben, wichtig ist. Entsprechende
Studienergebnisse (siehe Hattie- Studie) liegen vor.
Regelmäßige benotete Leistungsüberprüfungen ab Kl. 3 sind
notwendig, um gegenüber Schülerinnen/Schülern wie Eltern den erforderlichen
Leistungsanspruch deutlich zu machen und vor allem frühzeitig gezielt fördern
zu können.
Bis einschließlich Kl. 10 ist die konsequente Vermittlung
und Sicherung von Sprachbeherrschung mündlich wie schriftlich in allen Fächern
vordringlich wie auch sichere mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen
und historisch-politisches Grundwissen – also ein für jeden Einzelnen
verfügbares solides Wissensfundament mit Methoden- und Argumentationsbausteinen
im Sinne einer gemeinsamen kulturellen Basis. Die aktuell groß herausgestellte
sogenannte „Qualitätsoffensive“ mit dem Hinweis z.B. auf regelmäßige Lese- und
Schreibübungen benennt lediglich Selbstverständlichkeiten eines professionellen
Unterrichts und ist eigentlich ein Offenbarungseid hinsichtlich der
langjährigen Vernachlässigung erfolgreicher schulischer Chancenvermittlung.
Gerade mit Blick auf die Heterogenität der Schülergruppen
ist darüber hinaus die konsequente Sicherung einer angemessen ruhigen,
strukturierten Unterrichtsatmosphäre unverzichtbar. Dabei kommt dem Rückhalt
durch Schulleitung und Kollegium entsprechende Bedeutung zu, auch bei
notwendigen Sanktionen. Die ruhige Lernsituation ist besonders für schwächere
und zurückhaltende Kinder und Jugendliche entscheidend. Hier genau können sich
dann auch soziales Lernen und Teamfähigkeit beweisen und bewähren.
Einiges zum Lehrpersonal
Lehrkräfte gehören in den Unterricht und sind nicht zuerst
Moderatoren oder Sozialarbeiter. Sie müssen die Möglichkeit bekommen, sich auf
ihre eigentliche Profession auch tatsächlich konzentrieren zu können. Ihnen
gebührt Unterstützung, Respekt und Anerkennung. Daran fehlt es an vielen
Stellen. Dazu gehört der Rückhalt im Kollegium, durch Schulleitung,
Schulaufsicht und Eltern, wenn es um Beleidigungen, ungebührliches Verhalten
o.Ä. geht.
Der Einsatz von Quereinsteigern im eigenverantwortlichen
Unterricht sollte – auch zu ihrem eigenen Schutz – erst nach 6-monatiger
angeleiteter Praxis erfolgen. Bei der Auswahl im Vorfeld muss die Eignung
Vorrang vor der Quantität haben. Der aktuelle Senatsbeschluss zu den
Quereinsteigern sieht wiederum nur kurzfristige Maßnahmen in den Ferien und
weiterhin ausschließlich berufsbegleitendes „learning by doing“ vor – das
reicht nicht!
Die Ausbildung der Referendare sollte wieder durch
Seminarleiter sichergestellt werden, die für die jeweilige Schulart auch
ausgebildet sind und die Fakultas besitzen. Entsprechendes gilt für den Vorsitz
in den Zweiten Staatsprüfungen.
Inklusion gelingt nur bei Vorhandensein ausgebildeter
Sonderpädagoginnen und -pädagogen. Hier verbieten sich Notlösungen wie die
derzeit gelegentlich praktizierte, dass sogar Quereinsteiger ohne jede
Vorbereitung und Unterrichtserfahrung vor diese Aufgabe gestellt werden. Dann
stehen alle Bemühungen um Inklusion nur auf dem Papier.
Beim binnendifferenzierten Unterricht herrscht vielfach
Unsicherheit darüber, welche Folgen die Differenzierung für die Benotung hat.
Hier bedarf es verbindlicher Festlegungen, um die Anforderungen an Notengebung
ansatzweise zu erfüllen und die Benotung vor allem im Sinne der
„Chancengleichheit“ transparent und vergleichbar zu machen.
Eine deutliche Erhöhung der Studienplätze für das Lehramt
ist unverzüglich anzustreben. Dringend notwendig sind auch konkretere
fachlich-inhaltliche Vorgaben in der Lehrerbildung.
Vor allem die Rückkehr zur Verbeamtung ist entscheidend!
Berlin als einziges Bundesland, das nicht verbeamtet, steht sonst in einem
aussichtslosen Konkurrenzkampf bei der Werbung um Lehrkräfte, belegt u.a. durch
die starke Abwanderung nach Brandenburg.
Einiges zu Verwaltungshandeln/Schulinspektion
Grundsätzlich muss die Kommunikation der Verwaltung mit den
Adressaten Schulen, Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen/Schülern verbessert
werden, also regelmäßig, zuverlässig, qualifiziert und auf Augenhöhe.
Die Kriterien der Schulinspektion für „guten Unterricht“ sind zu überarbeiten. Diese orientieren sich derzeit zu sehr an äußeren – nicht selten ideologischen – und zu wenig an nachprüfbaren inhaltlich-fachlichen Aspekten. Ebenso sollten die Verfahrensweisen überdacht werden. Auch hier gilt:
Evaluieren können nur diejenigen, die Ausbildung und Erfahrung in der jeweiligen Schulart mitbringen.
Eine Konkretisierung der Rahmenlehrpläne ist überfällig. Die
derzeitige Inhaltsleere führt dazu, dass Standards nicht mehr verlässlich
erreicht werden und dass die Planung von Unterrichtsinhalten vor allem für
Quer- und Seiteneinsteiger, denen die schulische Erfahrung fehlt, aber
letztlich für alle Lehrkräfte erschwert wird. Warum nicht als verlässliche und
vergleichbare Basis wieder eine gewisse konkrete Kanonbildung mit Bandbreite
mit fachwissenschaftlich und methodisch-didaktisch sinnvollen Beispielangeboten
festlegen? Dies würde zudem – abgesehen von einer Erhöhung der Vergleichbarkeit
– die Lehrkräfte entlasten, weil sie nicht jedes Jahr zu Schuljahresbeginn
schulinterne Curricula erstellen müssten.
Im Übrigen sind wir der Meinung, dass die Berliner Schule,
wenn jetzt konsequent mit höchster Priorität seitens der Landesregierung
umgesteuert wird, noch zu retten ist – das haben alle, die hier lehren, lernen
, leisten verdient. Lassen Sie uns die Berliner Schule verbessern – kompetent
und professionell, leistungsorientiert und zugewandt und mit einer offenen,
positiven, fröhlichen Perspektive!
Zum Artikel: https://www.tagesspiegel.de/berlin/position-zur-berliner-schulpolitik-in-sorge-ueber-die-desastroesen-zustaende/24992038.html
Dieser Beitrag erscheint mit freundlicher Genehmigung der Autoren auf Schulforum-Berlin.