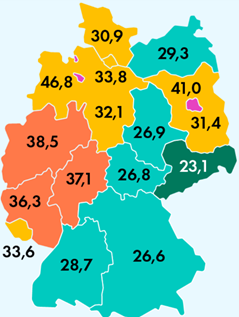An einer Berliner Grundschule zeigt sich, wie schnell pädagogische Leitlinien zur sozialen Norm werden.
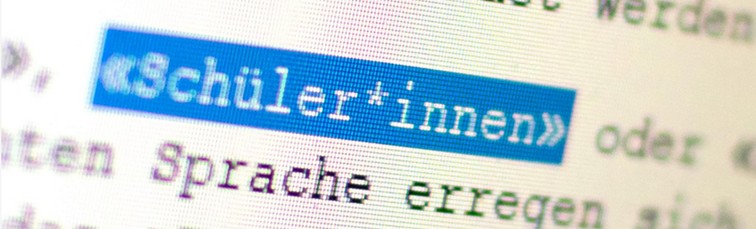
Quelle: dpa[1]
Text- und Bildauswahl sowie Erklärungen in den Fußnoten durch Schulforum-Berlin
Berliner Zeitung, 24./25. Januar 2026, unter BILDUNG, S. 27, von Sophie-Marie Schulz[2]
Man könnte meinen, das Thema Gendern habe sich erledigt.[3] Die große Empörung ist abgeflaut, die Debatte weitergezogen – irgendwohin zwischen Wahlkampf und Alltag. Doch an einer Berliner Grundschule zeigt sich: Die Frage, wie Sprache geregelt wird und wer sich den Regeln fügen muss, ist nicht verschwunden.
Der Berliner Zeitung liegen exklusiv Unterlagen einer Berliner Grundschule vor, die zeigen, wie eng Sprache, Pädagogik und Regeln inzwischen miteinander verknüpft sind. Außerdem liegt der Redaktion eine Mail eines Schulkindes vor, das schildert, wie sehr es das Gendern im Schulalltag unter Druck setze: Sprache werde „immer komplizierter“, die Regeln seien „verwirrend“, es fühle sich „sehr gezwungen“, „inklusiv“ zu sprechen.
Der Fall macht deutlich: Es geht längst nicht mehr nur um Sternchen und Doppelpunkte. Es geht um die Frage, ob das, was offiziell als „Angebot“ bezeichnet wird, im Klassenzimmer zur Pflicht wird.
Nicht Lehrer, sondern „Coaches“
Im Zentrum des Falls steht die Maria-Leo-Grundschule im Berliner Bezirk Pankow; eine Schule, die bundesweit als Vorzeigemodell für zeitgemäße Schulentwicklung gilt. 2025 wurde sie mit dem Deutschen Schulpreis[4] ausgezeichnet.
Die Jury lobte vor allem das sogenannte Lernhaus-Prinzip: Kinder arbeiten in offenen Lernumgebungen, unterstützt von multiprofessionellen Teams. Unterricht findet nicht mehr nur im klassischen Klassenraum statt, sondern in flexiblen Bereichen eines Neubaus, der nach dem Raumkonzept der „Compartments“ geplant wurde.
Auch sprachlich setzt die Schule auf einen Bruch mit Traditionen. Lehrkräfte heißen hier nicht Lehrer, sondern „Coaches“, Schülerinnen und Schüler werden als „Lernende“ bezeichnet. Zudem durchlaufen die Grundschulkinder ein mehrstufiges „Level-up-System“[5], das Selbstorganisation, Verantwortungsübernahme und Eigenständigkeit fördern soll. Wer jedoch ein solches Level erreichen will, muss einen „Vertrag“ unterzeichnen.
Gegendertes Aufstiegsversprechen
Der Berliner Zeitung liegen neben der „Lernhausordnung“, gemeint ist damit die Schulordnung, auch mehrere dieser Verträge[6] für die Stufen „Explorer“, „Explainer“ und „Expert“ vor. Die Dokumente sind durchgehend in gegenderter Sprache verfasst. Wer dem „Vertrag“ nicht zustimmen will, muss dies „begründen“.
In den Verträgen wird festgehalten, welche Vorteile mit dem jeweiligen Status verbunden sind. Etwa der Zugang zu anderer digitaler „Hardware“ oder die Möglichkeit, an anderen Orten zu lernen. Gleichzeitig wird aufgeführt, welche Anforderungen Kinder erfüllen müssen, um das nächste Level zu erreichen, beispielsweise: „Seiner/Ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht zu werden.“ Werden diese Pflichten nicht erfüllt, kann der Aufstieg abgebrochen werden.
Inklusive Verwirrung
So nüchtern diese Dokumente für den einen oder anderen formuliert sein mögen, erzählen sie doch nur die halbe Geschichte. Denn wie solche Konzepte im Alltag wirken, zeigt sich nicht in pädagogischen Leitbildern, sondern im Klassenzimmer und in der Wahrnehmung der Kinder.
In einer Mail, die bei der Plattform „Stoppt Gendern“ einging und der Berliner Zeitung vorliegt, schildert ein Schulkind seinen Alltag an der Maria-Leo-Grundschule vor allem als sprachliche Überforderung.
Die „Sprache in der Schule“ werde „immer komplizierter“, die Regeln seien „verwirrend“. Es gelinge dem Schuldkind nicht, immer „inklusiv“ zu sprechen und auch Mitschüler hätten damit Schwierigkeiten. Dennoch würden die „Coaches“ und die „Lernbegleitung“ immer wieder darauf hinweisen und die Kinder dazu anhalten, im Unterricht zu gendern.
Gendern stärke „die Demokratie“
Das Schulkind beschreibt außerdem, es fühle sich „sehr gezwungen“, diese Sprachregelungen mitzutragen. Nach eigener Darstellung wurde den Kindern erklärt, Gendern stärke „die Demokratie“[7] und sei deshalb notwendig.
Mit diesen Schilderungen konfrontierte die Berliner Zeitung die Schulleitung der Maria-Leo-Grundschule und bat um eine Stellungnahme oder ein persönliches Gespräch. Die Mail blieb unbeantwortet, stattdessen übernahm die Pressestelle der zuständigen Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die Beantwortung der Anfrage „in Absprache mit der Schule“.[8]
In der Antwort erklärt die Senatsverwaltung, die Maria-Leo-Grundschule verstehe Sprache als Bestandteil von „Demokratiebildung, Beziehungsgestaltung und gegenseitigem Respekt“.
Mit den Kindern werde altersgerecht darüber gesprochen, „dass Sprache Menschen sichtbar machen kann“ und „dass unterschiedliche Perspektiven und Identitäten in einer demokratischen Gesellschaft Anerkennung finden sollen“. Der Umgang mit gendergerechter beziehungsweise inklusiver Sprache sei dabei „ein Angebot zur Auseinandersetzung, keine verpflichtende Vorgabe und kein Zwang“.
Weiter heißt es: „Es hat keine Nachteile, wenn Kinder gendergerechte Sprachformen nicht anwenden.“ Gendergerechte Sprache sei „weder Bestandteil von Leistungsbewertungen noch Voraussetzung innerhalb des schulischen Level-up-Modells“. Bei den Verträgen handele es sich um „pädagogische Vereinbarungen im Rahmen des Level-up-Konzepts“, die Rechte und Pflichten im Schulalltag regelten – „etwa im Umgang mit Materialien, Lernorten oder digitalen Geräten“. Gendergerechte Sprache sei „kein verpflichtender Bestandteil dieser Vereinbarungen“.
Kein Zwang und trotzdem sehr gezwungen
Damit stehen zwei Beschreibungen nebeneinander, die kaum gegensätzlicher sein könnten: Ein Schulkind schildert, es fühle sich „sehr gezwungen“, bestimmte Sprachregelungen mitzutragen. Die Senatsverwaltung betont hingegen ausdrücklich, es gebe „keine verpflichtende Vorgabe und keinen Zwang“[9]. Auch Beschwerden, so heißt es in der Stellungnahme, seien „bislang nicht an die Schulleitung herangetragen worden“.
Nach einer weiteren Nachfrage der Berliner Zeitung, ob es offizielle Vorgaben oder Empfehlungen für gendergerechte Sprache an Berliner Schulen gebe und wo aus Sicht des Senats die Grenze zwischen pädagogischer Ermutigung und unzulässigem Druck verlaufe, blieb die Senatsverwaltung auffällig allgemein.
Grundsätzlich lernten Schülerinnen und Schüler „beim Schriftspracherwerb die Regeln der amtlichen Rechtschreibung kennen und werden befähigt, diese sicher anzuwenden“. Gendergerechte Schreibweisen, „die nicht Bestandteil des amtlichen Regelwerks sind“, dürften „nicht als falsch bewertet werden, sofern sie in sich schlüssig angewendet werden“.
Gleichzeitig macht die Antwort deutlich, dass Schulen sich bei der Frage nach einem Umgang mit solchen Schreibweisen eigene Regeln setzen können: „Die Gesamtkonferenz einer Schule kann hierzu ein verbindliches Vorgehen beschließen, soweit Fragen des Unterrichts und der Kompetenzvermittlung betroffen sind.“
Das Gefühl, es „richtig“ machen zu müssen
Damit bleibt zentral, was im konkreten Fall der Maria-Leo-Grundschule entscheidend ist: Wieviel Freiwilligkeit im Schulalltag tatsächlich übrig bleibt, hängt am Ende nicht von einer landesweiten Linie ab, sondern vom pädagogischen Kurs vor Ort.
Genau in dieser Grauzone liegt die politische Sprengkraft des Falls: Offiziell soll gendergerechte Sprache an Berliner Schulen kein Zwang sein und darf nach Angaben der Senatsverwaltung weder als Voraussetzung noch als Nachteil im Leistungsbereich auftauchen.
Gleichzeitig bleibt es den einzelnen Schulen überlassen, im Rahmen ihrer „Gesamtkonferenz ein verbindliches Vorgehen“ zu beschließen. Was als „Angebot“ beginnt, kann damit in der Praxis schnell zur Norm werden: nicht unbedingt über Noten, aber über Erwartungen, Korrekturen, Wiederholungen und über das Gefühl, es „richtig“ machen zu müssen.
Grenzen werden im Schulalltag ausgehandelt
[…] Kritik an der zunehmenden Verwendung gegenderter Sprache in Schulen kommt unter anderem von Sabine Mertens, Initiatorin der Initiative „Stoppt Gendern“ und Vorstandsmitglied des Vereins Deutsche Sprache e. V.
Mertens argumentiert, dass ein gemeinsamer Sprachstandard eine Voraussetzung für Verständigung und demokratische Teilhabe sei. „Der gemeinsame Sprachstandard ist die Grundlage einer demokratischen Gesellschaft“, sagt sie. Wenn dieser Standard aufgeweicht werde, fehle aus ihrer Sicht nicht nur sprachliche Orientierung, sondern auch eine gemeinsame Basis, auf der Wissen vermittelt und geteilt werden könne.
Sabine Mertens spricht vom „gendersprachlichen Chaos“
Durch die Zerstörung des anerkannten Standards fehlten „die Voraussetzungen für die Entstehung und Weiterentwicklung des Allgemeinwissens, für die Bildung und einen informierten öffentlichen Diskurs“, so Mertens. Aus ihrer Sicht entstehe damit nicht mehr Vielfalt, sondern Unsicherheit. Gerade dort, wo Sprache eigentlich Sicherheit geben müsse: im Unterricht.
Mit Blick auf Fälle wie den an der Maria-Leo-Grundschule spricht Mertens von einem „gendersprachlichen Chaos“, unter dem mittlerweile auch Kinder litten – mit möglichen Folgen für die persönliche Lernentwicklung. Gerade im Grundschulalter sei die Kluft zwischen altersgemäßen Bedürfnissen und zusätzlichen Sprachregeln besonders groß, so ihre Kritik. Kinder, die erst lesen und schreiben lernten, würden damit nicht entlastet, sondern zusätzlich belastet.
Dass ausgerechnet an einer preisgekrönten Vorzeigeschule ein Kind von Druck und Überforderung berichte, sei für Mertens ein Hinweis darauf, dass die Debatte längst nicht nur auf dem Papier geführt werde, sondern mitten im Schulalltag angekommen sei.
Moralisch aufgeladenes Lernen
Wenn der Senat erklärt, es gebe „keine verpflichtende Vorgabe und keinen Zwang“, gleichzeitig aber betont, dass Schulen ein „verbindliches Vorgehen“ beschließen könnten, bleibt die entscheidende Frage offen: Wer zieht im Zweifel die Grenze und wer prüft, ob sie eingehalten wird?
Die zitierte E-Mail ist zwar kein Beweis[10] für ein flächendeckendes Problem. Aber sie zeigt, wie sich Schule anfühlen kann, wenn Sprache nicht nur gelernt, sondern auch moralisch aufgeladen wird. Wenn ein Kind am Ende nicht mehr fragt, wie man etwas richtig schreibt, sondern wie man „richtig“ spricht.
Beitrag als PDF-Datei
[1] Bild aus: https://www.logo.de/gendern-gendergerechte-sprache-geschlechter-100.html
[2] Bereits am 19.01.2026 erschien in der Berliner Zeitung: „Exklusiv: Schulkind berichtet von Genderzwang an preisgekrönter Berliner Grundschule. Wo endet pädagogische Empfehlung und wo beginnt Zwang?“, Sophie-Marie Schulz. https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/exklusiv-schulkind-berichtet-von-genderzwang-an-preisgekroenter-berliner-grundschule-li.10014770
[3] Der Tagesspiegel kehrt zu dem zurück, was sowohl Morgenpost als auch Berliner Zeitung praktizieren: das Gendern ohne Sonderzeichen, 29.11.2023. Die Berliner Zeitung achtet auf eine „diskriminierungsfreie Sprache und nutze dafür alle vorhandenen sprachlichen Mittel“. Auf Doppelpunkte und andere Symbole werde dabei verzichtet, „da gute Lesbarkeit und sachliche Richtigkeit unserer Texte an oberster Stelle stehen und die überwiegende Mehrheit unserer Leser das Gendern mit Sonderzeichen ablehnt“.
[4] Mit dem Deutschen Schulpreis zeichnen die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung gute Schulen und ihre innovativen Schulkonzepte aus. Der Hintergrund: Die Robert Bosch Stiftung ist im „Forum Bildung Digitalisierung“ derzeit mit zehn großen deutschen Stiftungen vereinigt.
Betrachtet man die Strategie der im „Forum Bildung Digitalisierung“ zusammengefassten Akteure – darunter, man staune, die Deutsche Telekom Stiftung, die Bertelsmann Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, die Siemens Stiftung – und der mit ihnen verbundenen Konzerne genauer, entdeckt man ein perfektes Zusammenspiel. Es geht darum, das „digitale Bildungskonzept“ der Stiftungen gewinnbringend für die Unternehmen an unseren Schulen umzusetzen.
Ganz uneigennützig schreiben sie in ihrer web-Vorstellung: „Das Forum Bildung Digitalisierung setzt sich für die „gelingende digitale Transformation des Schulsystems ein“. Es gibt vor, „Orientierung zu stiften zu aktuellen Herausforderungen der Bildungssteuerung und Schulentwicklung in der Kultur der Digitalität“. Auch werben die im Forum zusammengeschlossenen Stiftungen, dass sie „skalierbare Praxislösungen für systemische Bedarfe wie die Qualifizierung oder Zusammenarbeit von Schulleitungen, Schulträgern und Schulaufsichten“ bieten. https://www.forumbd.de/verein/
Bei der digitalen Transformation des Schulsystems stehen die Schüler nur vordergründig im Mittelpunkt. Die Vereinzelung beim Lernen vor dem Bildschirm, die Abschaffung des Unterrichts, die Auflösung der Klassengemeinschaft, der Verlust von Sozialkompetenzen sowie der stete Leistungsabfall in den Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen, all das wird kommentarlos hingenommen.
[5] In der Gegendarstellung vom 26.01.2026 zu dem Artikel „Schulkind berichtet von Genderzwang an preisgekrönter Berliner Grundschule“ von Sophie-Marie Schulz, erschienen am 19.01.2026 in der Berliner Zeitung stellt die Maria-Leo-Grundschule Berlin-Pankow fest: „Das Level-Up-Modell steht in keinem Zusammenhang mit sprachlichen Vorgaben. Es dient der Förderung von Selbstwirksamkeit, sozialer Verlässlichkeit und eigenverantwortlichem Lernen – nicht der Durchsetzung bestimmter Sprachformen.“ https://maria-leo-grundschule.de/wp-content/uploads/2026/01/Gegensdartellung_Artikel_BZ_20260119.pdf
[6] Aus der Gegendarstellung: Bei den „Verträgen“ handelt es sich „um pädagogische Vereinbarungen im Rahmen des schulischen Level-Up-Modells („Explorer – Explainer – Expert“). Diese regeln ausschließlich Aspekte der Selbstorganisation, Verantwortungsübernahme und des sozialen Zusammenlebens im Schulalltag (z. B. Umgang mit Materialien, Lernorten oder digitalen Geräten). Gendergerechte Sprache ist kein verpflichtender Bestandteil dieser Vereinbarungen.“
[7] Aus der Gegendarstellung: „Sprache wird an der Maria-Leo-Grundschule im Rahmen von Demokratiebildung thematisiert – altersgerecht und dialogisch. Ziel ist es, Kindern zu vermitteln, dass Sprache Menschen sichtbar machen kann und Teil eines respektvollen Miteinanders ist. Dies erfolgt ausdrücklich als Angebot zur Auseinandersetzung, nicht als Norm oder Pflicht.“
[8] Die Gegendarstellung der Maria-Leo-Grundschule mit sieben Entgegnungen zu dem Artikel der Berliner Zeitung, erschien am 26.01.2026.
[9] Aus der Gegendarstellung: „An der Maria-Leo-Grundschule besteht kein Zwang zur Verwendung gendergerechter oder inklusiver Sprache. Gendergerechte Sprache ist weder verpflichtend noch Bestandteil von Leistungsbewertungen oder Voraussetzung für schulisches Fortkommen.“
[10] Aus der Gegendarstellung: „Der Artikel stützt sich maßgeblich auf einen anonymen, nicht überprüfbaren Einzelfall, der verallgemeinert und als Beleg für strukturellen Zwang interpretiert wird. Diese Darstellung wird der pädagogischen Praxis der Schule nicht gerecht.“