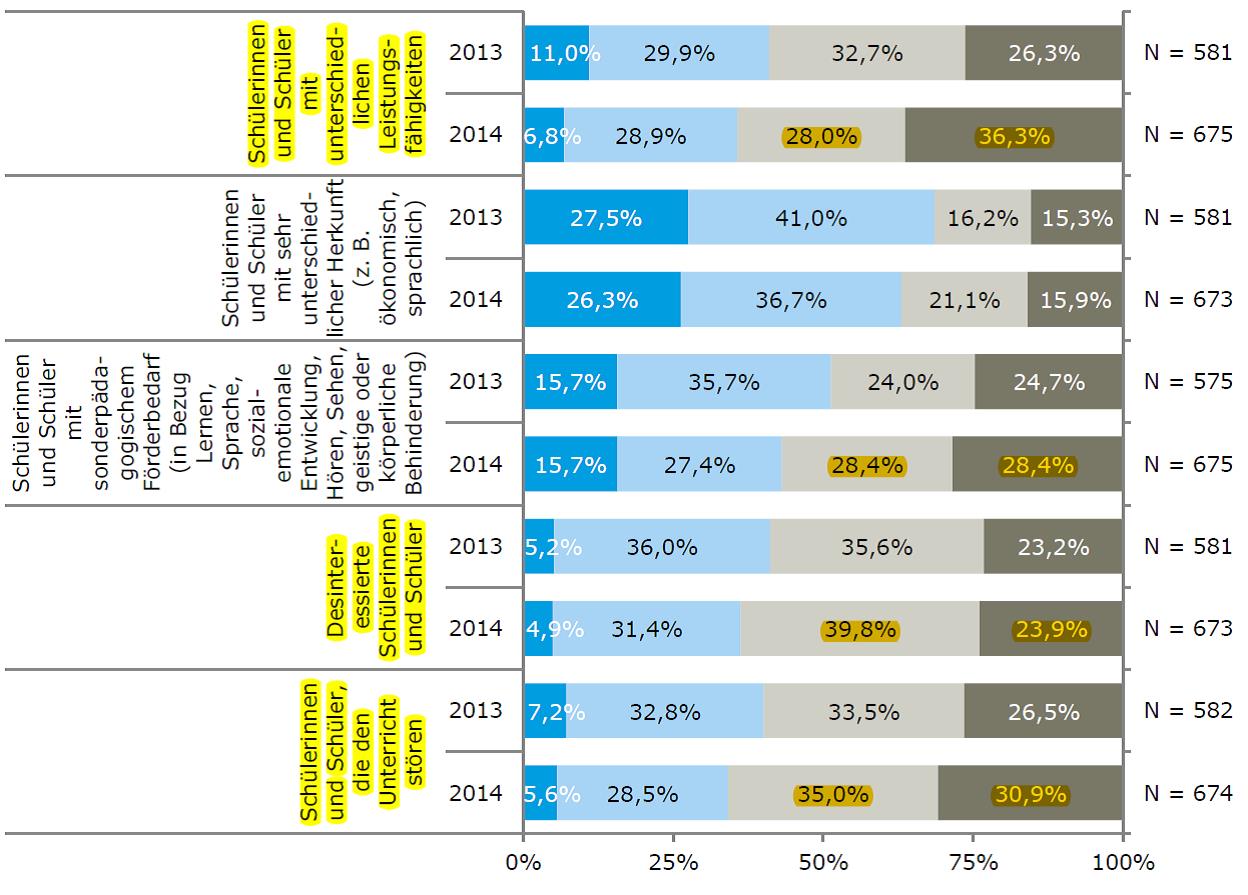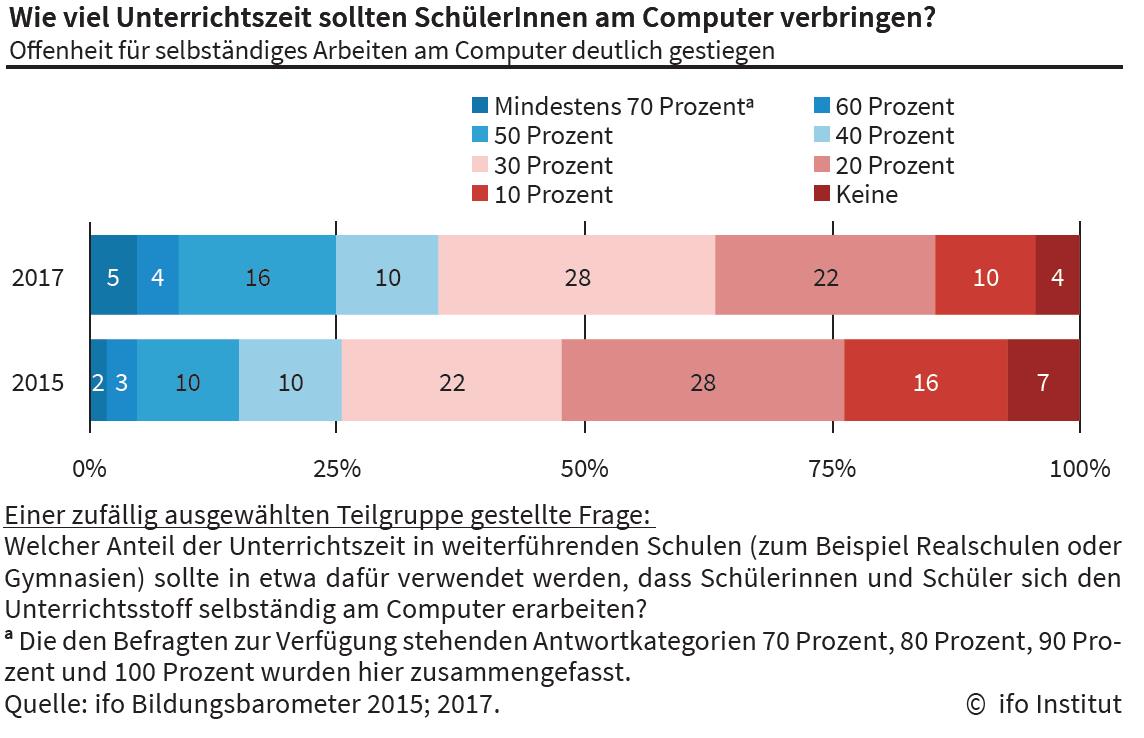Trojanisches Pferd „Digitale Bildung“. Auf dem Weg zur Konditionierungsanstalt in einer Schule ohne Lehrer?
Ein Vortrag bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Kreisverband Böblingen, zu den Bestrebungen von Google, Apple, Microsoft, Bertelsmann und der Telekom, die Bildung in die Hand zu bekommen. Und warum fast keiner diese Unterwanderung bemerkt.
Peter Hensinger, Pädagoge
Wir hatten schon viele Schulreformen, und nun wird von der Kultusministerkonferenz eine weitere angekündigt, die „Digitale Bildung“: Unterricht mit digitalen Medien wie Smartphone und Tablet-PC über WLAN.1 […]
Die Hauptinitiative der Digitalisierung der Bildung kommt von der IT-Branche. Im Zwischenbericht der Plattform „Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft“ steht, wer das Bundeswissenschaftsministerium berät – nämlich Akteure der IT-Wirtschaft: Vom Bitkom, der Gesellschaft für Informatik (GI) über Microsoft, SAP bis zur Telekom sind alle vertreten (BUNDESMINISTERIUM 2016:23). Nicht vertreten dagegen sind Kinderärzte, Pädagogen, Lernpsychologen oder Neurowissenschaftler, die sich mit den Folgen der Nutzung von Bildschirmmedien bei Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Die New York Times schlägt in einer Analyse Alarm: „How Google Took Over the Classroom“ (13.05.2017).2 Mit ausgeklügelten Methoden, den Hype um digitale Medien nutzend, greift Google nach der Kontrolle des US-Bildungswesens, auch der Kontrolle über die Inhalte.
[siehe auch: SZ, 16.06.2017, Google drängt in die Klassenzimmer]
Wer bei der Analyse und Bewertung dieser Entwicklung nur fragt „Nützen digitale Medien im Unterricht?“, verengt den Blick, reduziert auf Methodik und Didaktik und schließt Gesamtzusammenhänge aus. Denn die digitalen Medien sind mehr als nur Unterrichts-Hilfsmittel. Diesen Tunnelblick weitet die IT-Unternehmerin Yvonne Hofstetter. Sie schreibt in ihrem Buch „Das Ende der Demokratie“: „Mit der Digitalisierung verwandeln wir unser Leben, privat wie beruflich, in einen Riesencomputer. Alles wird gemessen, gespeichert, analysiert und prognostiziert, um es anschließend zu steuern und zu optimieren“ (HOFSTETTER 2016:37). […]
Geplant ist, das Schulbuch durch Smartphones oder TabletPCs zu ersetzen. Damit geben wir jedem Schüler eine Superwanze: „Smartphones sind Messgeräte, mit denen man auch telefonieren kann … Dabei entstehen riesige Datenmengen, die dem, der sie analysiert, nicht nur Rückschlüsse auf jedes Individuum erlauben, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes“ (HOFSTETTER 2016:26). Diese Geräte heben die grundgesetzlich geschützte Privatsphäre auf, sie ist aber ein Garant für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung.3 […]
Die persönlichen Daten aus Facebook, Google und Twitter sind das Gold des 21. Jahrhunderts, v.a. für die Weckung von Konsumbedürfnissen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert deshalb die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über die Daten, er schreibt, das Ziel von BigData sei es, über den „direkten Kundenzugang … die Kontrolle über die Kundenschnittstelle (zu) gewinnen”. „Ein derartiges Agentenmodell [!!!] gewinnt an Bedeutung, da empirisches Wissen über den Kunden und seine Bedürfnisse von enormem Wert ist” (RB & BDI 2015: 8). Das ist ein wesentlicher Grund, warum die Industrie Smartphones und TabletPCs in KiTas und Schulen etablieren will. Sie ermöglichen die Datenerfassung bereits dort, wo die Kunden der Gegenwart und Zukunft sozialisiert werden: „Die Schulen werden faktisch zu Keimzellen eines Big-Data Ökosystems“, heißt es in einem BigData Befürworter-Buch (MAYER-SCHÖNBERGER 2014:52). Heute schon ist die Überwachung der Verhaltens-, Kommunikations-, Lern- und Entwicklungsdaten und der Handel mit den digitalen Zwillingen ein Milliardengeschäft.5 […]
Führt der Einsatz von digitalen Medien zu besserem Lernen?
Konnte inzwischen mit Vergleichsstudien belegt werden, dass digitale Medien zu besseren Lernerfolgen führen als die bisherige „analoge“ Erziehung? Nein, im Gegenteil. Dazu verweise ich auf die Beiträge auf der Anhörung im hessischen Landtag am 14. Oktober 2016 zum Thema „Kein Kind zurücklassen – Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen“. Die dort vortragenden Experten Burchardt, Lankau und Spitzer weisen nach, dass alle bisherigen Untersuchungen ergaben, dass der Einsatz der digitalen Medien nicht zu besserem Lernen führt. (BURCHARDT 2016, LANKAU 2016, SPITZER 2016). Dazu vier Beispiele: […]
Fußnoten und Literaturhinweise sowie weitere Artikel des Referenten siehe Vortragsskript.
Zum Vortrag: Peter Hensinger, Trojanisches Pferd „Digitale Bildung“. Auf dem Weg zur Konditionierungsanstalt in einer Schule ohne Lehrer? Diskussionsveranstaltung beim Kreisverband der GEW, Kreisverband Böblingen, am 21.06.2017.
Der Leiter der Telekom-Studie „Schule digital. Der Länderindikator 2015“, Wilfried Bos (Institut f. Schulentwicklung IFS, TU Dortmund), weist auf den fehlenden Nutzen von Digitaltechnik für bessere Unterrichtsergebnisse hin:
„Die Sonderauswertung hat auch gezeigt, dass Staaten, die in den letzten Jahren verstärkt in die Ausstattung der Schulen investiert haben, in den vergangenen zehn Jahren keine nennenswerten Verbesserungen der Schülerleistungen in den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik oder Naturwissenschaften erzielen konnten. Die verstärkte Nutzung digitaler Medien führt offensichtlich nicht per se zu besseren Schülerleistungen. Vielmehr kommt es auf die Lehrperson an.“ (S. 8)
Zitiert wird die PISA-Sonderauswertung über „Students, Computers and Learning“. Die laut Bos daraus folgende Konsequenz – noch mehr Digitaltechnik für die Schulen, noch mehr Schulungen der Lehrerinnen und Lehrer durch IT-Anbieter und verpflichtende Direktiven der Rektorate an die Lehrerkollegien, dass Digitaltechnik im Unterricht verpflichtend eingesetzt werden müsse – dürfte eher dem Auftraggeber der Studie (die Telekom ist ein Anbieter technischer Infrastruktur und digitaler Dienstleistungen) denn pädagogischer Notwendigkeit geschuldet sein. Auffällig ist, dass weder nach Altersstufen noch nach Fachinhalten, nicht nach Schulformen oder Unterrichtsmethoden unterschieden wird. Digitaltechnik und die Beschulung durch Software scheint selbst dann Allheilmittel zu sein, wenn OECD-Studien das Gegenteil belegen.
aus: Prof. Dr. phil. Ralf Lankau, Digitalisierung und schulische Bildung, Anhörung durch die Enquetekommission „Kein Kind zurücklassen – Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen“, Thema „Digitalisierung“, S. 4f (14. Oktober 2016)
weitere Publikationen zu „Digitalisierung und schulische Bildung“ unter: http://lankau.de/category/publikationen/vortraege/
siehe auch: Bündnis für HUMANE BILDUNG, DigitalPakt Schule der Kultusminister: Irrweg der Bildungspolitik
[…] Die Diskussion um die „Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft“ oder die „digitale Bildungsrevolution“ entbehrt eines wesentlichen Fundaments, nämlich eines rational gebildeten Begriffs von Bildung, ohne den man der sich abzeichnenden Entwicklung und auch dahinter stehenden Interessen in vielfacher Hinsicht hilflos ausgeliefert ist. Die vollmundigen Versprechungen stehen auf tönernen Füßen, es gibt keine empirischen Belege für die in Aussicht gestellten positiven Effekte im Bildungswesen. Die zunehmende Technisierung unterrichtlicher Prozesse droht auf fundamentale und genuine Aufgaben von Schule und Unterricht gegenläufig zu den Verheißungen destruktive Wirkungen zu entfalten, indem sie deren konstitutive Elemente zurückdrängt und beschneidet: Schule und Unterricht als Orte des Miteinanders, der vielfältigen sozialen Interaktion, einer gelebten Solidarität, unterschiedlichster Lehr-Lern- und Sozialformen, des Ausfechtens von Konflikten und Sich-Abarbeitens am Gegenüber, der Freude am (besseren) Argument und der Sache und des gemeinsamen Fortschreitens im Erkennen. Insofern erweist sich der digitale Wandel als dialektischer Transformationsprozess. Es drohen umzuschlagen: selbstbestimmtes Lernen in Fremdsteuerung, Transparenz in Überwachung, Emanzipation durch Zugang zu Informationen in Abhängigkeit von intransparenten, technokratischen Strukturen mit autoritären Zügen, Bildungsgerechtigkeit in kontingenten Zugang zu „analogen“ Bildungsgütern, Fortschritt in Rückwärtsgewandtheit, Wissenschaft in Fixierung des Intellekts auf das Bestehende. […]
aus: Bildung im digitalen Wandel – zur Dialektik eines Transformationsprozesses, Dr. Burkard Chwalek, erschienen in: Beruflicher Bildungsweg – bbw, 7 + 8/2017, S. 6-10