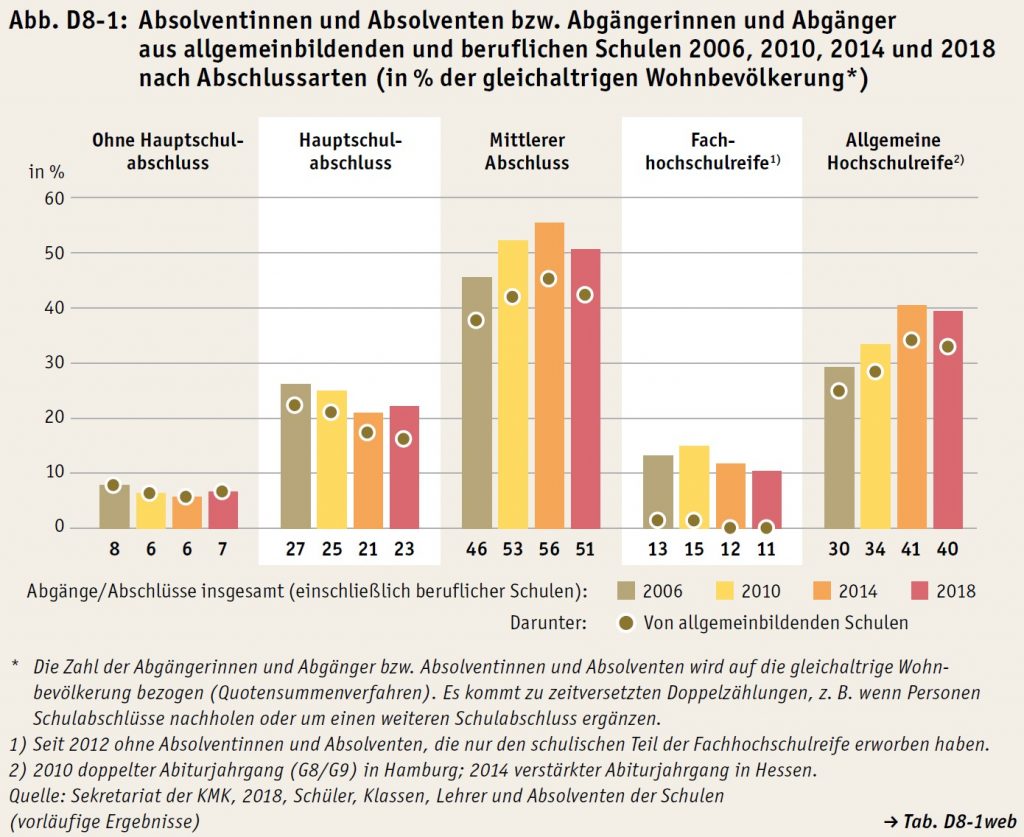„Franz, du schaffst das!“
Entscheidend für den Bildungserfolg sind glaubwürdige Lehrerinnen und Lehrer, die fördern, fordern und ermutigen. Das geht im Reform-Aktivismus unter.
Von Carl Bossard
Prof. Dr. Carl Bossard war Direktor der Kantonschule Luzern und Gründungsrektor der Pädagogischen Hochschule Zug.
„Franz, du schaffst das!“ Mit dieser Erwartungshaltung hätten ihn die Lehrer gestärkt. So erinnert sich der Unternehmer Franz Käppeli an seine Schulzeit. (1) Der Gründer der Labor medica AG wird in eine arme Bauernfamilie geboren. Als elftes von zwölf Kindern wächst er in Muri im Freiamt auf. Sein Studium an der ETH Zürich berappt er selber. Der promovierte Biochemiker Käppeli baut eines der führenden medizinischen Laboratorien der Schweiz auf, verdient ein Vermögen und stiftet gegen 15 Millionen Franken als Beitrag an die Renovation des Klosters Muri – dies mit der einzigen Begründung, seine Lehrer hätten ihm viel zugetraut und ihn ermutigt.
Tiefenwirkung statt Oberflächen-Reformen
Lehren ist wirken. „Teacher, know thy impact!“ – „Wisse, was du bewirken kannst!“ Auf diese einprägsame Kurzformel bringt der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie die Kernbotschaft seiner grossen empirischen Unterrichtsstudie: Entscheidend für den Bildungserfolg ist, dass die Lehrenden die eigene pädagogische Wirkungsweise kennen und sie immer wieder kritisch hinterfragen. (2)
Beim Bauernbuben Franz Käppeli wirkten die Lehrerinnen und Lehrer. Sie bewirkten viel und sie wirkten nachhaltig oder eben „tief“. Nicht umsonst unterscheidet die Wirksamkeitsforschung zwischen den „tiefen Strukturen“ des Unterrichts und Oberflächenmerkmalen. So wirken die Glaubwürdigkeit der Lehrperson und ein dem Lernen förderliches Klima beispielsweise viel stärker als webbasiertes Lernen oder die vielgelobte Freiarbeit. Letztere erweist sich als erschreckend ineffektiv.
Wer die Reformkaskade der letzten Jahre und Jahrzehnte überblickt, erkennt viel Oberflächliches: klassenübergreifendes, altersdurchmischtes Lernen, Lernumgebungen mit Stationenlernen, weiter die dominante Methode des selbstgesteuerten oder selbstorientierten Lernens und das forcierte Arbeiten in Gruppen und Projekten.
Vieles wurde in schnellem Takt reformiert: einheitliche Schulstrukturen, nationale Bildungsziele, Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, [kompetenzorientierte Lehrpläne] und kompetenzorientierter Unterricht, dazu neue Fächerkombinationen und zwei Fremdsprachen in der Primarschule. Doch viel scheint nicht genug zu sein. Vielmehr geht es zügig weiter. Im Moment priorisiert die Politik vor allem zwei Bereiche: Digitalisierung und Ökonomisierung der Bildung.
Bildungsvollzugsbeamte
Im PISA-Zeitalter regiert die Logik der Ökonomie. Sie bringt auch den Wechsel von der Input- zur Output-Steuerung. Kompetenzstandards normieren die Ziele von Lern- und Ausbildungswegen. Die erwarteten und als relevant bezifferten Bildungseffekte werden in ein testfähiges Format transformiert. Mit den Messmethoden der empirischen Bildungsforschung sind sie erfassbar und kontrollierbar. So wird Bildung geplant und gesteuert, limitiert und formatiert. Ankreuztests und andere Messmethoden prüfen die Erreichung der geplanten Effekte.
Wichtig aber wäre die Frage: Suchen wir tatsächlich in der Bildung primär nach Messbarem? Wenn ja, wäre es sinnvoll, dies dann in bestimmten Wertungen und Rankings abzubilden. Oder sollten wir nicht vielmehr zuerst fragen, was uns wertvoll und wichtig ist und dann erst messen? Diese entscheidende Frage wird nicht gestellt. Dafür wird umso intensiver getestet und gemessen.
Noch nie war im Schweizer Bildungswesen so viel von Kontrolle und Rechenschaft die Rede wie heute. In diesen Zusammenhang gehört auch das sogenannte Bildungsmonitoring, das permanente Untersuchen, Überprüfen und Überwachen. Darum werden bereits fünfjährige Kindergartenkinder auf Buchstaben getestet und auf Zahlenkenntnisse überprüft. Die Ergebnisse stehen feinsäuberlich auf einem kleingerasterten Blatt. Es umfasst sage und schreibe 40 Punkte. Die Kindergärtnerin muss sie mit den Eltern im Detail besprechen, orientiert am Output, fixiert auf das Ziel des Lernweges. Bildungsprozesse werden bürokratisch überwacht. Lehrerinnen und Lehrer mutieren so zu Bildungsvollzugsbeamten und Kinder zu Vollzogenen, wie es der sensible Dichter Peter Bichsel wahrnimmt. (3)
Reformen ohne Wirkung
All diesen pädagogischen Reformen gemeinsam ist das Versprechen, dass es besser wird als bis anhin – irgendwann und irgendwie und natürlich zum Wohl der Kinder und Jugendlichen. Doch was von diesen Reformen wirkt wirklich? Man weiss es schlicht nicht. Eine Wirkung sei empirisch nicht nachzuweisen, gesteht der Bildungsökonom Stefan C. Wolter, Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung, freimütig. (4) Ob die Reformkaskade wissenschaftlich zu rechtfertigen ist? Danach fragt niemand.
Doch warum konzentriert sich die offizielle Bildungspolitik primär auf Strukturen und Oberflächenphänomene? Warum ist kaum von den Tiefenmerkmalen der Bildungsprozesse die Rede und warum so wenig vom pädagogischen Wirken der Lehrerinnen und Lehrer, von der Interaktion zwischen ihnen und den Schülern? In genau diesen Bereichen liegt ja der Schlüssel zur Schulqualität.
Effektives Lernen ist das Resultat identifizierbarer Lehraktivitäten, allgemeiner gesagt: erfolgreichen Lehrens (5) und engagierten Unterrichtens. Erfolge stellen sich dort ein, wo Lehrpersonen vital präsent und mit humaner Energie am Weiterkommen ihrer Schüler interessiert sind. Das lässt sich auch datenbasiert belegen. Alle Einflussgrössen, in denen sich die personale Dimension des Unterrichts widerspiegelt – etwa das Emotionale, das Beziehungshafte, das Dialogische, das kognitiv Anregende – erzielen hohe Wirkwerte auf die Lernleistung der Kinder und Jugendlichen.
Bildung lebt von Interaktion
Die Basisdimensionen von Unterrichtsqualität liegen darum in den Tiefenstrukturen: Wie gut gelingt es der Lehrerin, den Unterricht störungsfrei und strukturiert zu steuern? Wie weit gelingt es dem Lehrer, dass sich alle Schülerinnen und Schüler aktiv mit den Lerninhalten auseinandersetzen, intensiv üben und die Lernzeit effektiv nutzen? Und auf welche Weise helfen Lehrerinnen und Lehrer ihren Kindern, wenn Verständnisprobleme auftreten? Wie konstruktiv geben sie Feedback und wie sehr ist das Zwischenmenschliche von Respekt und Wertschätzung geprägt?
Der Ort schulischer Bildung ist eben nie die Struktur allein, nie die Methode allein und auch nie das Medium allein. Der Ort schulischer Bildung ist die Interaktion zwischen Menschen; in diesem Dazwischen entsteht Wirkung. Und dazu zählt auch der heitere Zwischenruf, zählt die verstehende Zuwendung, zählen Anerkennung und Anregung, aber auch Widerstand und Widerrede.
„Franz, du schaffst das!“: Für Franz Käppelis Lernweg waren die Lehrer der zentrale Faktor – nicht Strukturen und nicht Oberflächenmerkmale. Der erfolgreiche Unternehmer hatte Pädagogen, die an ihn glaubten und ihn ermutigten.
Dieser Beitrag erscheint mit freundlicher Genehmigung des Autors auf Schulforum-Berlin. Der Beitrag erschien zuerst auf der Website des „journal21„.
(1) Erich Aschwanden (2013), Das Millionen-Geschenk ohne Hintergedanken, in: NZZ, 13.07.2013
(2) John Hattie (2012), Visible Learning for Teachers. London, New York: Routledge, S. IX
(3) Peter Bichsel (2015), Kinderarbeit im Bildungsvollzug, in: Ders., Über das Wetter reden. Kolumnen 2012–2015. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 33f
(4) Martin Beglinger, „Das ist vernichtend“, in: NZZ, 31.08.2018, S.53
(5) Helmut Heid (2007), Was vermag die Standardisierung wünschenswerter Lernoutputs zur Qualitätsverbesserung des Bildungswesens beizutragen?, in: Dietrich Benner (Hrsg.), Bildungsstandards. Kontroversen – Beispiele – Perspektiven. Paderborn: Verlag Schöningh, S. 37