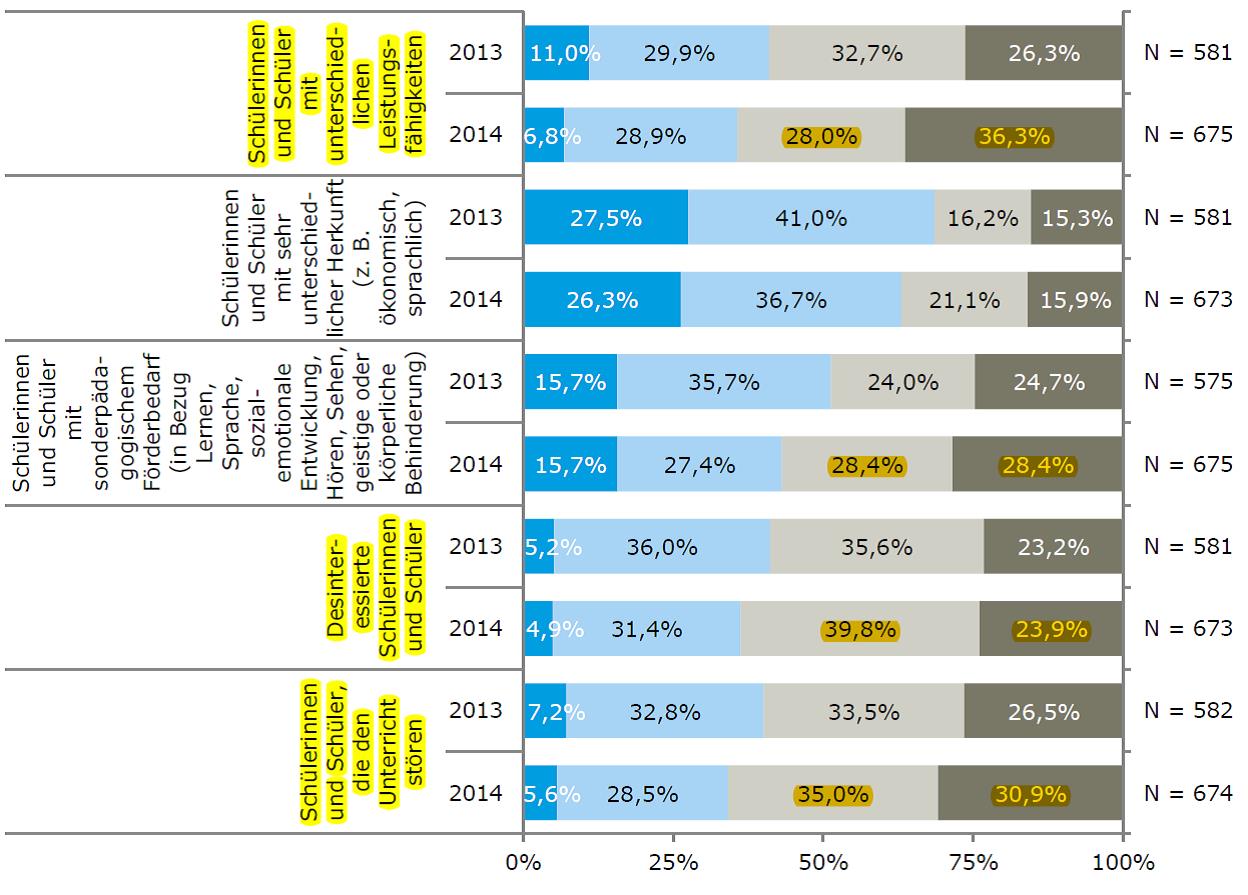Evolution im Kopfstand
Wie die kruden Ideen des Peter Fratton auch nach seinem Abgang noch in Baden-Württemberg ein Eigenleben führen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.10.2017, Bildungswelten, Marco Wehr
Peter Fratton kam, sah und verschwand. Seine vier pädagogischen Urbitten „Erziehe mich nicht! Bring mir nichts bei! Erkläre mir nicht! Motiviere mich nicht!“ überzeugten nicht jeden. Der Schweizer, von der rot-grünen Koalition in Baden-Württemberg 2011 als Bildungsberater bestallt, musste sich Kritik gefallen lassen. Er reagierte beleidigt und strich 2013 die Segel. Doch das von ihm kreierte Bildungsmärchen führt weiter ein gespenstisches Eigenleben. Ist es einfach zu verführerisch?
Wir erinnern uns: Statt von „Lehrern“ und „Schülern“ sprechen Fratton und seine Gesinnungsgenossen von „Lernbegleitern“ und „Lernpartnern“. Hinter diesen Begriffen verbirgt sich die Fama, dass mit dem rechten pädagogischen Vademecum in der Hand das Lernen seinen Schrecken verliert. Da Lernen ein menschliches Elementarbedürfnis ist, entfalten sich die Lernpartner wie die Blumen – fast von allein. Und weil der kluge Gärtner nicht am Gras zieht, damit es schneller wächst, unterlässt es der Lernbegleiter, den Lernpartner in ein zeitliches Korsett zu zwingen. Jedes Pflänzchen wächst nach seinem eigenen Tempo, und der Lernbegleiter beschränkt sich aufs Hegen und Pflegen, zur rechten Zeit ein bisschen Dünger und Wasser, bis die Pflanze endlich in ihrer schönsten Blüte steht. Kein Stress mehr, kein Zeitdruck, keine Noten, kein Frust. Dass eine solche Bildungsidylle – hier ein wenig überspitzt dargestellt – etwas Narkotisierendes hat, kann man gerade noch nachvollziehen. Und man könnte sie als Schrulle abhaken, wenn die Folgen nicht so gravierend wären, die bis zum heutigen Tag zu bestaunen sind. Viele Erzieherinnen trauen sich nicht mehr, mit den Kindern zu basteln und ihnen etwas beizubringen, weil sie den Vorwurf scheuen, den autonomen Lernprozess des Kindes in unzulässiger Weise zu unterminieren. Nach wie vor gibt es Bildungspläne, die vom frattonschen Denken durchwebt sind. Und manchmal wird es völlig skurril: Bei einer vom brandenburgischen Bildungsministerium veranstalteten Tagung fragte ein Redner, wie ein rechter Lernbegleiter auf die Frage eines Kindes zu antworten habe, das wissen will, wie das weibliche Reh heißt. „Ricke?“, fragte eine Teilnehmerin naiv. Falsch. Die richtige ,,Antwort“ lautet: „Warum fragst du das?“ und „Wie fühlst du dich dabei?“.
Da hört die Romantik auf, und man muss sich ernsthaft fragen, was an der Theorie vom autonomen Lernen dran ist. Da der Schweizer sein geradezu virales Narrativ mittlerweile verschriftlicht hat, kann man genauer hingucken. Doch wer von Fratton eine stringente Argumentation erwartet, wird enttäuscht. Dessen Prosa irrlichtert durch die Wissenschaften und wimmelt von Widersprüchen. Das beginnt schon mit dem Habitus des Autors. Der Schweizer gefällt sich in der Rolle des bescheidenen Wahrheitssuchers. Gerne kokettiert er mit dem momentanen Stand seines Unwissens. Von diesem gefälligen Duktus unterscheidet sich jedoch die Art und Weise, mit der er dem Leser seine Kernbotschaften um die Ohren haut. Auf einmal hantiert er wie in der formalen Logik mit Axiomen, Postulaten und Regeln. Und bei der Formulierung dieses scheinbar wissenschaftlichen Systems greift er wie selbstverständlich auf Erkenntnisse der Kybernetik, der System- und Chaostheorie sowie der fraktalen Mathematik zurück. Das mag den einen oder anderen Pädagogen beeindrucken. Das Problem?
Fratton scheint nicht so genau zu wissen, wovon er spricht. Die Verwirrung beginnt schon bei der Begrifflichkeit. So redet er stolz von „Axiomen“, da er das Wort. „Grundsatz“ nicht mag. Ein Blick ins etymologische Wörterbuch hätte geholfen:
Ein Axiom ist ein Grundsatz, der keinen Beweis benötigt. Und wie lautet dann eine axiomatische Wahrheit a la Fratton? „Lernen ist eine Existenzform.“ Eine Existenzform? Was meint er damit? Ist das ein Lebenskonzept wie das des Mönchs? Oder wollte er sagen, dass Lernen für den Menschen eine existentielle Notwendigkeit darstellt? Wohl letzteres. Doch um sicher zu sein, muss man eine seiner sprunghaften Argumentationsketten dechiffrieren.
Eine zentrale Argumentation funktioniert ungefähr so: Am Anfang war die Urzelle, und die hatte eine semipermeable Membran. Diese erlaubt es der Zelle zu entscheiden, was sie aufnimmt und was nicht. Und genauso machen es angeblich auch die Sinnesorgane, über die wir Menschen verfügen. Daraus zieht Fratton einen gewagten Schluss, der sich seiner Meinung nach einer evolutionären Überlegung verdankt: Da in uns Menschen solche Zellen am Werke sind und wir zudem über „entscheidende“ Sinnesorgane verfügen, sind wir beim Lernen autonom. Zellen und Sinnesorgane entscheiden schließlich auch selbst, was sie reinlassen und was nicht! Da ist man sprachlos. Weder die Urzelle noch die Sinnesorgane entscheiden irgend etwas. Wenn sie es täten, würde auch die Filtertüte entscheiden, wie der Kaffee wird. Deshalb lässt sich aus diesen Pseudofakten auch keine Lernautonomie ableiten. Und ein Axiom erst recht nicht! Ein Axiom ist nämlich nicht das Ergebnis einer wie auch immer gearteten Schlusskette, sondern deren Voraussetzung. Dass eine derart inkonsistent begründete Lernphilosophie in der deutschen Bildungslandschaft eine so große Wirkung hat, sollte den Kultusministerien zu denken geben. Weiterlesen