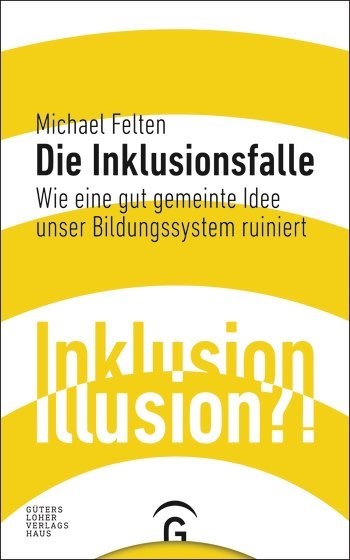»Gegen den Algorithmus kann es kein Aufbegehren geben«
Ralf Wurzbacher im Gespräch mit Matthias Burchardt. Über den digitalen Angriff auf die Schulen, asoziale soziale Netzwerke und die Morgendämmerung des Maschinenmenschen.
Dr. Matthias Burchardt ist Akademischer Rat am »Institut für Bildungsphilosophie, Anthropologie und Pädagogik der Lebensspanne« an der Universität zu Köln und stellvertretender Geschäftsführer der Gesellschaft für Bildung und Wissen (GBW).
Ralf Wurzbacher: (…) Die Online- und Spielsucht in Deutschland nimmt immer gravierendere Ausmaße an. Laut der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler, CSU, gelten heute bereits 560.000 Menschen als computersüchtig. Kinder und Jugendliche sind dabei besonders gefährdet. [Im Oktober 2016] hat die Bundesregierung die Auflage eines fünf Milliarden Euro schweren Programms zur Ausstattung aller deutschen Schulen mit modernster digitaler Technologie angekündigt. Den sogenannten Digitalpakt #D bewirbt das von Johanna Wanka, CDU, geführte Bundesbildungsministerium mit: »Einmaleins und ABC nur noch mit PC.« Wie gut schlafen Sie noch bei all dem, oder Ihre Kinder?
Matthias Burchardt: Frau Wanka entfesselt die nächste Welle durch einen Pakt, der den Charakter einer Gewalttat im Gewand einer Wohltat hat. Mir bereitet dieser Angriff auf die Schulen tatsächlich große Sorgen. Meine Kinder dagegen schlafen gut, weil ihre innere Uhr abends nicht vom Bildschirmlicht gestört wird. Tatsächlich gehören Schlaf- und Konzentrationsstörungen zu den bedenklichen Nebenwirkungen dieser Systeme, von der hohen Suchtgefährdung ganz abgesehen.
Was ist so anders daran, mit Smartphone oder Tablet zu lernen, verglichen mit den bisher gängigen Methoden?
Wenn ich den Slogan richtig deute, ist Frau Wanka nicht in erster Linie an einer soliden Geräteausstattung gelegen, die dann nach fachdidaktischen Entscheidungen der Lehrerin oder des Lehrers bedarfsweise eingesetzt wird. Ihr geht es um einen Umbau der pädagogischen Substanz von Schule: »nur noch mit PC«. Bisher galt aus guten Gründen, dass Lernen in Beziehung stattfindet, verantwortet von einer in Fach und Vermittlung souveränen Lehrperson. Diese soziale Dimension von Bildung wird aber verdrängt, wenn der Bildschirm zunehmend zum Bezugspunkt wird. Es ist übrigens eine Illusion zu glauben, dass diese Geräte ein neutrales Instrument wären, das in den Händen der richtigen Leute zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen würde. Zum einen vergrößert digitalisierter Unterricht die soziale Spaltung, anstatt sie zu überwinden. Mehr denn je wird dann nämlich das kulturelle Kapital der Eltern ausschlaggebend für den Bildungserfolg sein. Zum anderen verkennt man die Eigengesetzlichkeit des Mediums, das einem nämlich nur dann gehorcht, wenn man sich ihm unterwirft. Im Grunde funktionieren die digitalen Medien wie ein Fetisch. Sie suggerieren dem Nutzer Freiheit und Souveränität, liefern ihn aber einer Abhängigkeit aus. Sowenig der Seidenstrumpf oder die Götterstatue tatsächliches Liebesglück oder religiöse Erlösung zustande bringen, sowenig können digitale Lehrmittel und Medien die Aufgaben eines Lehrers ersetzen oder auf technischem Weg die Bildung von Schülern bewerkstelligen.
Wie und warum »unterwirft« man sich der digitalen Technologie, wenn man, um beim Beispiel zu bleiben, das Alphabet auf dem Tablet einübt?
Diese Unterwerfung hat mehrere Dimensionen. Zum einen hat Lernsoftware bei allem Geblinke und Gedudel die Dialogfähigkeit eines Formulars und die Sturheit eines Sprachmenüs bei einer Servicehotline. Rückfragen, Verständigung oder auch Einflussnahme auf Inhalt und Art es Lerngeschehens sind nicht wirklich möglich. Im zwischenmenschlichen Unterricht kann der Schüler mittendrin die Sinnfrage aufwerfen, ganz im Sinne von Ruth Cohn: »Störungen haben Vorrang!« Software ist rigoroser als jeder autoritäre Lehrer, die Entmündigung geschieht auf dem Wege des anonymen Algorithmus, gegen den es kein Aufbegehren geben kann. Und dann gibt es eine noch verborgenere Form der Unterwerfung: Die Geräte spionieren ihre Nutzer aus, erheben Daten, generieren Verhaltensprofile und gewinnen so ein Herrschaftswissen, das zur Steuerung der Menschen genutzt werden kann. Sicher wird man hier behaupten, dass dies alles der Optimierung von Lernen dienen soll. Aber worin besteht dieses Optimum? Mündigkeit oder Anpassung an Sachzwänge, die uns die sture Maschine präsentiert – als Einübung für die Insassen der »Industrie 4.0«? (…)
Vor zwei Jahren hat Bertelsmann verkündet, ganz groß ins Geschäft mit Bildung einzusteigen und damit in drei bis fünf Jahren eine Milliarde Euro zu erlösen. Riesige Profite verspricht sich Europas führender Medienkonzern vor allem durch E- Learning-Angebote für Schulen und Hochschulen. Fast zeitgleich hat die Bundesregierung im Sommer 2014 ihre »digitale Agenda« ausgerufen, in deren Rahmen man die deutschen Bildungseinrichtungen zunächst mit der Hardware versorgen will, die es für die schönen neuen Softwarelösungen braucht. Die Koinzidenz beider Vorstöße lässt erahnen: Gütersloh und das Kanzleramt sind schon jetzt bestens vernetzt.
Eine Kollegin war in Berlin anwesend, als Frau Wanka die Digitalisierungsinitiative vorgestellt hat. Sie berichtete, dass die Ministerin ausdrücklich auf ihren »Freund Jörg Dräger« [Bertelsmann-Stiftung] verwiesen hat, der ihr den erfolgreichen Einsatz digitaler Lehrmittel demonstriert habe. Zudem müsse man an die Daten der Schüler kommen. Über diese anekdotische Annäherung hinaus bedarf es natürlich einer sytematischen Aufarbeitung der Beziehungen zwischen der Politik und der Stiftung. Einen ersten, wesentlichen Beitrag dazu hat die Landtagsfraktion der Piraten in Nordrhein-Westfalen mit einer großen Anfrage zu den Verflechtungen zwischen Gütersloh und Düsseldorf geleistet. Die Antwort der Regierung liegt vor, aber obwohl sie durchaus skandalöse Aspekte enthält, berichten die Qualitätsmedien nicht darüber.
Bei Bertelsmann fällt einem ja zuerst der TV-Sender RTL ein. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie hören, dass der Konzern jetzt ganz groß auf Bildung macht?
Tatsächlich sind die Sender der RTLGruppe nicht unbedingt für ihre hochwertigen Bildungsangebote in die Geschichte eingegangen. Es entsteht insofern ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man sich in Sachen Bildung »beratend« in die Politik einmischt, während die eigenen Formate eher wie ein Abgesang auf die Ansprüche einer humanistischen oder emanzipatorischen Kultur erscheinen. Kritiker werfen der Stiftung deshalb vor, dass hinter den sozialpolitisch konsensheischenden Zielen im Grunde die Agenda einer neoliberalen Umsteuerung verfolgt wird. Nebenbei kann man natürlich auf dem Digitalisierungsmarkt viel Geld verdienen.
Wenn die Interessenlage so durchsichtig ist, warum machen dann alle relevanten gesellschaftlichen Kräfte bei diesem Hype mit? Selbst die Gewerkschaften singen das Hohelied auf das digitale Klassenzimmer und bekritteln allenfalls, dass es dafür mehr und besser ausgebildete Lehrkräfte bräuchte. Dabei gibt es doch Kritik aus berufenem Munde: Fast alle Kinderärzte warnen, dass der Gebrauch der neuen Medien die körperliche und kognitive Entwicklung von Kindern stört und mitunter krank und blöd machen kann. Will das einfach keiner hören?
Über die Gründe kann man nur spekulieren. Hier treffen wohl Naivität und erfolgreiche Lobbyarbeit aufeinander. Das Internet und der Computer wurden von Beginn an als Militärtechnologien genutzt und gefördert. In einer Verquickung von politischen und ökonomischen Interessen wurden auch die Privathaushalte seit den 1980er Jahren mit Geräten und in den 1990ern mit Internetanschlüssen versorgt. Computer wurden als pädagogisch wertvoll gepriesen und das Netz als Ort der freien Zirkulation von Informationen. In der »Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace« entwirft John Perry Barlow 1996 die Utopie einer neuen Welt der Freiheit, die nicht mehr durch staatliche Repression kontrolliert wird. Man hätte damals stutzig werden müssen, dass dieses Manifest ausgerechnet in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum vorgetragen wurde. (…)
Ende August war in einem Artikel der New York Post zu lesen, dass leitende Angestellte aus dem Silicon Valley ihre Kinder gerade nicht in diese hippen Technoschulen schicken, wo schon kleine Menschen mit Smartphone und Tablet großgezogen werden. Und gleichzeitig machen diese Leute Milliardenprofite damit, dass Heranwachsende ihr ganzes Leben bei Facebook, Twitter und Youtube entblößen. Ist es wirklich nur das Geld, das die Digitalhysterie befeuert?
Es ist bekannt, dass die Kinder von Steve Jobs kein I-Pad oder I-Phone hatten. Ganz nach dem Motto: »Analog ist das neue Bio« gestalten Eltern das Leben ihrer Kinder bewusst frei von digitalen Medien, sogar wenn sie mit IT ihr Geld verdienen. Ich glaube aber nicht, dass es nur um Geschäfte geht. Es entsteht ein Instrument totaler Überwachung und Steuerung, das den Ansprüchen einer aufklärerisch-emanzipatorischen Gesellschaft fundamental entgegenwirkt und uns zu Insassen im Raum eines technischen Kraftfeldes macht, das nicht im Netz endet, sondern auch das Politische selbst vernichtet. Die US-Politologin Wendy Brown hat darauf aufmerksam gemacht, dass mit dem Verfahren des Governance – als einem Steuerungsmodell gesellschaftlicher Prozesse auf Basis von Daten, Kennziffern und Sollwerten – den Akteuren quasi eine neue geistige Firmware aufgespielt wurde. Das führt dazu, dass ein jeder die Illusion von Handlungsfreiheit und ethischer Integrität hat, aber gleichwohl aufgrund der Systemlogik genau dieselben Entscheidungen trifft, die auch der durchtriebenste Verfechter des Neoliberalismus getroffen hätte. (…)
Sie waren für die Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag Sachverständiger zum Thema Digitalisierung in der Enquetekommission »Kein Kind zurücklassen«. In Ihrem Gutachten heißt es klipp und klar: »Die Digitalisierung ist nur ein weiterer Schritt zur Entstaatlichung und Ökonomisierung des Bildungssystems.« Wundert es Sie nicht, dass Die Linke im Bundestag davon gar nichts wissen will? Die bildungspolitische Sprecherin Rosemarie Hein warnte Frau Wanka vor einem Monat allen Ernstes davor, »bei der Ausstattung der Schulen keine halben Sachen zu machen«.
Ich würde mich sehr freuen, auch mit den Akteuren auf Bundesebene ins Gespräch zu kommen, denn ich unterstelle zunächst einmal den meisten Politikern guten Willen, aber auch Unkenntnis. Dass eine gewisse Geräteausstattung pädagogisch und organisatorisch sinnvoll ist, würde ich auch unterstreichen. Doch eine solche Überlegung darf nicht auf die Analyse der Interessen und Folgen verzichten. Wenn die Linkspartei gegen gesellschaftliche Spaltung vorgehen möchte, sollte sie zur Kenntnis nehmen, dass Digitalisierung keine Lösung, sondern ein Problem ist.
Spielerei, Bedrohung, Stütze – wie man den Einsatz digitaler Technologie im Klassenzimmer bewertet, hat oft mehr mit Ideologie als mit Auseinandersetzung zu tun.
zum Artikel: Die TAGESZEITUNG jungeWelt, 19./20. November 2016, Nr. 271, »Gegen den Algorithmus kann es kein Aufbegehren geben«