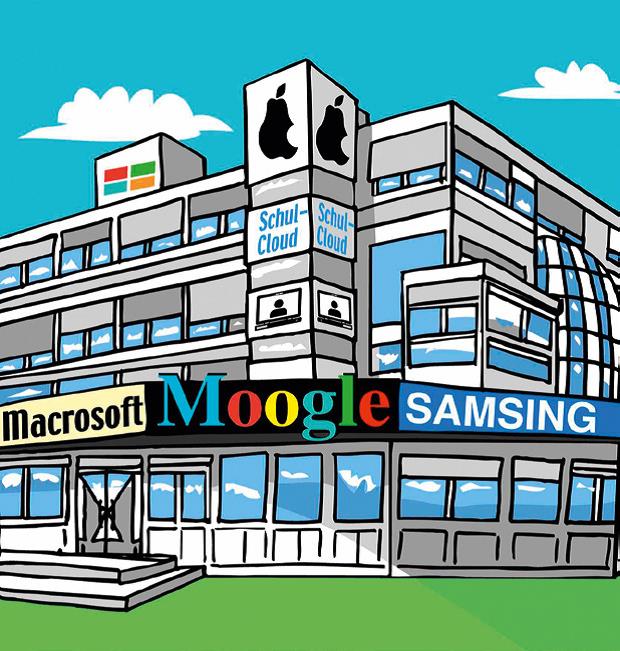Eine friedliche Insel in Neukölln
Das Ernst-Abbe-Gymnasium liegt mitten in einem Berliner Brennpunkt. 94 Prozent der Schüler haben Migrationshintergrund. Wie gelingt dort der Schulalltag?
Berlin, 24. 04. 2019, Heike Schmoll
Auf der Sonnenallee in Berlin sieht man sich unversehens in den Orient versetzt. Die Geschäfte tragen arabische Schriftzeichen, bieten entsprechende Brautmoden und mit weißem Tüll geschmückte Schatzkästlein für die Mitgift, daneben finden sich Billigläden für Haushaltsutensilien und Praktisches. Hinzu kommen viele Bäckereien, Cafés und Shisha-Bars, in denen fast ausschließlich Männer sitzen, Nuss- und Kaffeeröstereien, Imbisstheken, Grill-Restaurants und Falafel-Buden. Die Sonnenallee war einmal das arabische Viertel, inzwischen ist sie mit ihrem Altbaubestand auch bei anderen Milieus begehrt. Die Mieten steigen. Viele Einwanderer leben dort auf engstem Raum – nicht selten teilen sich achtköpfige Familien eine Dreizimmerwohnung. Die größte Gruppe bilden schon seit den siebziger Jahren die Türken, die wegen einer Zuzugssperre für Kreuzberg, Wedding und Tiergarten nach Nordneukölln gezogen waren. Ansonsten wohnen hier längst Albaner, Bosnier und Tschetschenen, aber auch europäische Einwanderer wie Italiener, Spanier und Portugiesen zieht es zunehmend in das Viertel.
Mittendrin befindet sich ein ehrwürdiges Backsteingebäude, das wie aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Es ist das Ernst-Abbe-Gymnasium mit einem Migrantenanteil von 94 Prozent, von der Schulbürokratie in Berlin als Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache (ndH) bezeichnet. Wer die Schultür öffnet, begegnet als Erstes einem freundlichen Sicherheitsmann. Den braucht das Gymnasium genauso wie alle anderen Schulen in Neukölln, die Kosten dafür übernimmt der Bezirk. Der Schulhof erweckt den Eindruck eines geschützten Raumes inmitten der lärmumtosten Straße. Solche Schutzräume für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die unter schwierigsten sozialen Bedingungen aufwachsen, ist dem Schulleiter Tilmann Kötterheinrich-Wedekind besonders wichtig. Zu oft sind erboste Eltern oder rachsüchtige Brüder in die Schule gekommen, die einen vermeintlichen Übeltäter unter den Mitschülern vermöbeln wollten. Erst vor kurzem gab es wieder einen gewalttätigen Zwischenfall – allerdings vor der Schule. Auch der wird geahndet: Die Schule hat Anzeige gegen die daran Beteiligten erstattet. Aber auch innerschulisch gibt es viele Sanktionsmöglichkeiten vom schriftlichen Verweis über einen Klassenwechsel bis zum Schulverweis, dem Schulaufsicht und Gesamtkonferenz zustimmen.
Über besondere Disziplinprobleme während des Unterrichts kann die Schule nicht klagen, obwohl in den siebten Klassen teilweise 29 Schüler sitzen. Zwei Drittel sind in den meisten Klassen Mädchen, fünf bis sechs tragen ein Kopftuch. Wegen der sechsjährigen Berliner Grundschule ist die erste Gymnasialklasse, ein Probejahr. Von knapp über hundert Schülern müssen am Ende des Schuljahrs 15 bis 20 Prozent wieder gehen, obwohl sie oft Vorbereitungskurse besucht haben. Sie stehen allen Schülern der umliegenden Grundschulen offen und werden in Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften angeboten. Die Schulleiterin der Grundschule in der Köllnischen Heide, Astrid-Sabine Busse, bestätigt, dass nur Schüler zugelassen werden, die auf einer glatten Zwei stehen und fest vorhaben, aufs Abbe-Gymnasium zu gehen. Früher habe sich ein Gymnasium überhaupt nicht um Grundschulen geschert, das sei beim Abbe ganz anders geworden, sagt Busse, deren Schülerschaft mehrheitlich arabischer Herkunft ist. Unter den Eltern an ihrer Schule gibt es fließend Deutsch sprechende Väter aus dem arabischen Raum, aber auch Mütter, die auch nach 30 Jahren kein Wort Deutsch können. Die dritte vermeintlich integrierte Elterngeneration gibt es für Busse nicht.
Das Hauptproblem für die Schüler, die zu Hause wenig oder kein Deutsch sprechen, bleibt während der gesamten Schulzeit Deutsch als Bildungssprache. Noch in der neunten Klasse haben einige selbst im Gymnasium Probleme beim Vorlesen mit Fremdwörtern wie „Interpretation“ und erwecken nicht immer den Eindruck, als verstünden sie auch, was sie gerade vortragen. Das Abbe-Gymnasium hat sich deshalb Sprachbildung auf die Fahnen geschrieben. Es nimmt am bundesweiten Projekt BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift) teil, das vom Bundesbildungsministerium gefördert wird. In den Klassenstufen sieben und acht werden zusätzlich zum Deutschunterricht zwei Stunden Deutsch als Zweitsprache erteilt.
Außerdem händigt die Schule jedem einen Schulplaner aus, der nicht nur Raum für Aufgabennotizen lässt, sondern auch sprachliche Wendungen für unterschiedliche Unterrichtssituationen und Fächer bereithält, an denen sich Schüler orientieren können. Alle Arbeitsaufträge werden schriftlich erteilt – meist durch einen Tafelanschrieb, und selbst im Sportunterricht geht es immer wieder darum, Sprache zu üben. In der Sporthalle unterbricht die arabischstämmige Lehrerin, eine frühere Schülerin des Abbe-Gymnasiums, die praktischen Übungen für das Basketballspiel, um die Korbleger-Regeln zu erläutern. Die Schüler sitzen im Kreis auf dem Boden und müssen auch ausdrücken können, was sie gleich in Bewegung umsetzen. In allen Fächern wiederholen die Fachlehrer die Aussagen von Schülern und korrigieren dabei vorsichtig grammatische Fehler. Schwimmunterricht kann die Schule schon deshalb nicht anbieten, weil die Familien die jungen Mädchen nicht teilnehmen ließen. Manche Schülerinnen wollten auch schon in langen Kleidern zum Sportunterricht gehen.
In solchen Fällen greift die türkischstämmige und muslimisch religiös aufgewachsene Safiye Celikyürek, die Deutsch und Englisch unterrichtet, ein und entgegnet, dass der Islam keine Sportkleidung vorschreibe und eine weite Jogginghose mit einem langärmeligen T-Shirt völlig opportun sei. Celikyürek trägt kein Kopftuch wie viele ihrer Schülerinnen, das würde der Schulleiter auch nicht befürworten. Er hält das Neutralitätsgebot gerade an seiner Schule für eine Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Einen Gebetsraum duldet er genauso wenig wie öffentliches Beten auf den Gängen mit Publikum. Das Beten könne nach allen religiösen Regeln auch auf den Abend verschoben werden und Religion sei Privatsache, sagt Kötterheinrich-Wedekind. Dass die Schüler am Samstag in die Moscheeschulen gehen, kann die Schule ohnehin nicht verhindern.
So etwas wie eine „Toiletten-Scharia“ duldet die Schule nicht. Es gab offenbar schon Mitschüler, die andere beim Gang auf die Toilette dabei überprüften, ob sie während des Ramadan heimlich essen oder trinken. „Wer nicht fastet, ist kein richtiger Muslim“, sagen dann vor allem die Jungs, die den Ramadan wie einen Entsagungswettbewerb verstehen. Das Fasten im Ramadan ist für den Schulalltag und Prüfungszeiten ein riesiges Problem. Manchmal wissen nicht einmal die Eltern, dass ihr Kind während des Ramadan fastet. Es gibt Schüler, die aufgrund der völligen Flüssigkeits- und Nahrungskarenz schon nach der dritten Stunde nicht mehr können und sich krankmelden. Der soziale Druck der Mitschüler ist oft stärker als häusliche Erwartungen. In diesem Jahr beginnt der Ramadan am 6. Mai, die Prüfungen für den mittleren Schulabschluss fallen genau in diese Zeit. Celikyürek fastet nicht und versucht auch die Schüler davon zu überzeugen, dass sie zumindest trinken sollen, das Fasten aber am besten ganz lassen, vor allem während der Prüfungszeit.
Auch beim Kopftuchtragen herrscht in den Klassen Gruppendruck. In den siebten Schuljahren tragen von dreißig Schülern etwa sechs Mädchen ein Kopftuch, in den höheren Klassen werden es immer mehr. Oft kommen sie nach den Sommerferien mit Kopftuch wieder. Aber, so berichtet Celikyürek, es gibt manchmal auch Mädchen, die das Kopftuch wieder ablegen – nach einem Gespräch mit der Tante in einem Fall. Vor allem die Mädchen müssen nach der Schule oft im Haushalt mithelfen. Für sie ist der Schutz- und Bildungsraum Schule ganz besonders wichtig. Nicht wenige Schüler bleiben deshalb gern bei der Hausaufgabenbetreuung in der Schule. Es gebe Schüler, die ihre Aufgaben zu Hause in der Badewanne machten, weil sie keinen Arbeitsplatz hätten, sagt Kötterheinrich-Wedekind.
Abendliche Theaterbesuche mit Lehrern sind schwierig. Neulich habe sie eine Schülerin nach dem Theater persönlich nach Hause begleitet, die Eltern hätten sie sonst nicht mitgehen lassen, sagt Celikyürek. Der Schule, die vollständig saniert ist, Internet in jedem Klassenraum hat und eine neue Turnhalle nutzen kann, beschert die Schülerzusammensetzung 100000 Euro aus dem sogenannten Bonusprogramm in Berlin. Schulen mit mehr als 40 Prozent Schülern aus Hartz-IV-Familien, die von der Zuzahlung zu Lernmitteln befreit sind, können bis zu 100000 Euro im Jahr mehr an Mitteln beantragen. Am Ernst-Abbe-Gymnasium haben 80 Prozent der Schüler eine Lernmittelbefreiung. Für die Bewilligung der Senatsfinanzen müssen die Schulen Ziele entwickeln, was und wen sie fördern wollen – und dafür selbständig Verträge abschließen und Fachkräfte engagieren. Die Hausaufgabenbetreuung, die Honorarkräfte für die Bibliothek, die Schülersozialhilfe, die Konflikte unter Schülern schlichtet. So berichtet eine Siebtklässlerin vom Streit mit einem Kameraden, von dem sie sich auch als Mädchen angegriffen fühlte. Nach einem einstündigen Gespräch mit den Sozialhelfern konnten sich die beiden versöhnen.
Kötterheinrich-Wedekind will sich über die Ausstattung nicht beschweren und gehört überhaupt nicht zum jammernden Teil seiner Zunft. Er beschönigt nichts, auch in seiner Schule nicht, und hält mit unangenehmen Wahrheiten nicht hinter dem Berg. Der Abischnitt seiner Schule liege bei 2,7, und das Abbe stehe damit auf einem der letzten Plätze des Berliner Rankings. Aber es ist schon eine Leistung, dass 93 bis 96 Prozent der Schüler das Berliner Abitur schaffen, und das bei den beiden zweiten Fremdsprachen Latein und Französisch. Latein wird von 40 Prozent der Schüler angewählt, und viele verlassen die Schule mit einem Latinum, nur wenige studieren. Aber die Schule ist schon froh, wenn die weiblichen Abiturienten nicht ein Jahr nach dem Abitur mit einem Kinderwagen an der Schule vorbeikommen und damit ihren Verzicht auf eine Ausbildung dokumentieren.
Von Ermäßigungsstrategien halten weder der Schulleiter noch sein Lehrerkollegium etwas. Die herausfordernde Schülerzusammensetzung wollen sie nicht als Ausrede für niedrigere Ansprüche gelten lassen. Kötterheinrich-Wedekinds Schule gehört auch wegen des Lateinunterrichts zu den Partnerschulen der Lehrerbildung in der Humboldt-Universität. Er als Altphilologe hätte es einfacher haben können und als Lateinlehrer am renommierten Arndt-Gymnasium in Berlin-Dahlem bleiben können, aber das wollte er nicht. Während die Eltern in Dahlem oft zu zweit beim Elternabend erschienen, muss das Ernst-Abbe-Gymnasium um die Mitwirkung der Eltern kämpfen. In arabischen und türkischen Familien überlassen die Eltern der Schule gern allein die Verantwortung für die Bildungslaufbahn ihrer Kinder. Häufig läuft der Fernseher mit Satellitenprogrammen nahezu rund um die Uhr, oder die Kinder werden am Wochenende dem Computer überlassen. Für Rückzugsmöglichkeiten zum Lesen oder Lernen sorgen die Eltern nicht. Sie sind gern bereit, einen Kuchen fürs Schulfest zu backen, aber wenn es um echte Mitarbeit oder gar Präsenz geht, wird es schwierig. Wenn einmal zehn bis zwölf von etwa 1200 Eltern im Elterncafé der Schule waren, gilt das schon als Erfolg. Sie werden dort fürstlich empfangen, können ohne Anlass und Termin Lehrer und Schulleiter treffen. Von Möglichkeiten der Schullaufbahnberatung bis hin zu Gesundheitsthemen reichen die thematischen Angebote der Schule. Aber das Kollegium arbeitet weiter daran, Schülern aus schwierigsten Verhältnissen Bildungsaufstiege zu ermöglichen, mit Rückschlägen und stetigem Engagement.
zum Artikel: F.A.Z. – POLITIK, 24. April 2019, BERLIN, Heike Schmoll, Eine friedliche Insel in Neukölln