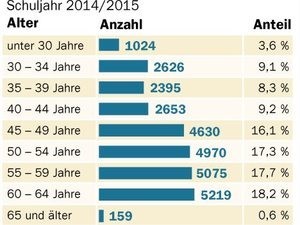Wer´s glaubt, wird wuselig
Warum viele Lehrer an Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg wenig von dieser Schulform halten – und das Gefühl haben, dass offene Kritik daran unerwünscht ist.
11.02.2016, Heike Schmoll, FAZ
Der Lehrer hat kapituliert vor der Disziplinlosigkeit seiner Schüler. Nach einem Nervenzusammenbruch im Unterricht ist er krankgeschrieben. Der ausgebildete und erfahrene Gymnasiallehrer mit drei Unterrichtsfächern war zuletzt an einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg eingesetzt. (…)
Alleine ist der Lehrer mit seinem Scheitern nicht, es gibt nicht wenige Kollegen, die sich in der neuen Schulform überfordert fühlen. „Ich bin doch kein Psychologe, kein Therapeut, kein Logopäde, kein Förderschullehrer, kein Horterzieher (…)“ berichtet er. (…)
Als „Lernbegleiter“, erzählt eine Hauptschullehrerin an einer Gemeinschaftsschule, unterrichte sie an ihrer Schule zwar die „alte Hauptschulklientel“, müsse nun aber in vier verschiedenen Niveaustufen (Gymnasial-, Realschul-, Hauptschul- und Förderschulniveau) Aufgaben bereitstellen, um alle Kinder gleich gut beim Lernen zu begleiten. „Diese Herkulesaufgabe ist aber aus meiner Sicht nicht zu bewerkstelligen“. Die Darstellung der Lehrerin gleicht den Erfahrungen der meisten Gemeinschaftsschullehrer, die mit dieser Zeitung über ihre Arbeit gesprochen haben. Allesamt Lehrer, die guten Willens und hoch motiviert sind, sich von den neuen Unterrichtsformen und dem Ganztagsbetrieb aber zermürbt fühlen. (…)
Der Tübinger Bildungswissenschaftler Thorsten Bohl, hat deshalb weniger Pflichtstunden (Deputat) und mehr Personal verlangt, „um Leistungsunterschiede abzubauen und die große Belastung der Lehrer zu senken“, was Kultusminister Andreas Storch (SPD) umgehend ablehnte, zumal die Gemeinschaftsschule schon über eine ungewöhnlich gute Ausstattung verfügt und bei der Lehrerzuweisung bevorzugt wird. (…)
Bedenklich stimmt, dass Kritik an der neuen Schulform vielerorts nicht geduldet wird. Lehrer, die das Konzept grundsätzlich kritisieren, fühlen sich als Nestbeschmutzer ausgegrenzt oder disziplinarrechtlich zum Schweigen gebracht. (…)
Viele Lehrer, die dieser Zeitung Auskunft gaben, fürchten aber um ihre Existenz, wenn sie an die Öffentlichkeit treten. Ihre Namen und Schulorte werden hier und im folgenden deshalb nicht genannt. Die Wahrhaftigkeit aller Erfahrungsberichte ist eidesstattlich versichert worden.
Ein Gymnasiallehrer an der Gemeinschaftsschule berichtet: „Ich selbst bin in fünf Fächern fachfremd im Unterricht, und es wird stets erwartet, trotzdem ein hohes Niveau anzubieten“.(…) Die beiden Fächer, die er studiert hat, darf er jedoch nicht unterrichten.
Eine Gymnasiallehrerin an der Gemeinschaftsschule berichtet, (…) an ihrer Schule sei fachfremder Unterricht „eine Selbstverständlichkeit“. Das werde damit begründet, „dass Grund- und Hauptschullehrer ja schon immer fachfremd unterrichtet haben“. (…)
In seiner siebten Klasse erreiche kein Gemeinschaftsschüler auch nur das mittlere, also das Realschulniveau, berichtet ein Lehrer.
Ein Gymnasiallehrer hat in seiner fünften Klasse probeweise die Lernstandserhebung in Deutsch schreiben lassen (…). 52 Prozent seiner Fünftklässler lagen bei der Lernstandserhebung unter dem erwarteten Niveau. Ihre Lesegeschwindigkeit bewegte sich auf dem niedrigsten Level, auch beim Leseverständnis erreichte der weitaus größte Teil der Schüler nur das unterste Niveau, nur eine Schülerin wies die Fähigkeiten auf, die in der fünften Klasse eigentlich erreicht sein müssen.
Das sind genau die Grundlagen, die für jeden späteren Abschluss zählen. Schließlich waren Schülern und Eltern doch in Hochglanzbroschüren bessere Lernergebnisse durch die Gemeinschaftsschule versprochen worden. Der Beweis dafür steht noch aus. (…)
zum Artikel: FAZ, Bildungswelten, 11.02.2016, Heike Schmoll, Wer´s glaubt, wird wuselig