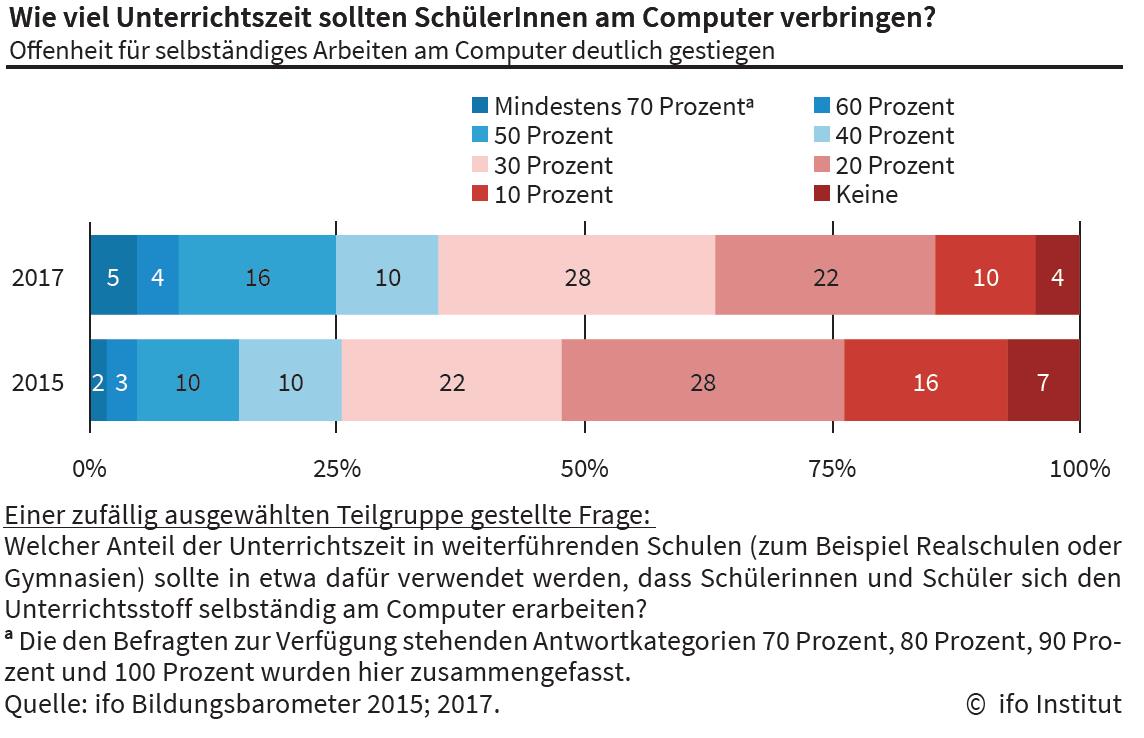Große Klassen und die „Neue Lernkultur“ industrialisieren den Lehrerberuf.
Von Nils Björn Schulz
Dr. Nils Björn Schulz ist Lehrer am Robert-Havemann-Gymnasium in Berlin.
Lehrerinnen und Lehrer sind zu Arbeitern einer hybriden Bildungsindustrie geworden. 50-Stunden-Wochen und Fließbandarbeit am Schreibtisch bestimmen den Berufsalltag vieler Kolleginnen und Kollegen – vor allem an Gymnasien. Die fortschreitende Digitalisierung, die Test- und Evaluationseuphorie und die Kompetenzorientierung der Neuen Lernkultur, wie sie Christoph Türcke in seinem Buch „Lehrerdämmerung“ nennt [siehe Bücherliste], haben innerhalb von knapp fünfzehn Jahren ein ganzes Berufsfeld industrialisiert und die Schule in eine Lernfabrik verwandelt. Das Produktionsziel: höhere Abiturientenquoten bei gleichzeitiger Absenkung des Anspruchsniveaus, wie die jüngsten Studien des Frankfurter Bildungsforschers Hans-Peter Klein zeigen konnten. [Siehe dazu auch für Berlin die Studie von Angela Schwenk und Norbert Kalus, Auswertung der Abiturdaten von 2006 bis 2016.]
Die Niveauabsenkung wird vor allem durch das ständige Gerede über Qualität und Qualitätsmanagment kaschiert. Aber für die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer ist sowieso eine ganz andere Kategorie zentral: die der Quantität. Es ist die schiere Quantität an Klassenarbeiten, Noten, Tests, Evaluationen, Methodentrainings – und die Lautstärke in den Klassenräumen, die erschöpft. An Gymnasien sitzen bis zu 30 Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum, in Berlin sind es sogar bis zu 32.
Man kann es ja begrüßen, dass die Disziplinargesellschaft verabschiedet wurde, jedoch hat man deren Raum- und Zeitstruktur beibehalten. Klassenräume und Stundenrhythmen gehören einem Typus an, den Michel Foucault als Einschließungsmilieu bezeichnete. Nur lassen sich Kinder und vor allem pubertierende Jugendliche so nicht mehr disziplinieren.
Aufgrund überbordenden Gebrauchs digitaler Medien völlig dezentriert, können sich viele in den vorgegebenen Strukturen nicht mehr konzentrieren. Die täglichen Mediennutzungszeiten Pubertierender variieren je nach Studie zwischen 5 und 7 Stunden. Es ist laut geworden in den spätmodernen Lernfabriken. Gerade die kooperativen Lernformen, die auf die Dezentrierung reagieren und sie zugleich verstärken, werden schon in der Grundschule eingeübt und lassen je nach Lerngruppe in den Räumen den Lärmpegel bis auf 80 Dezibel ansteigen. Anderen Berufsgruppen wird da Gehörschutz verordnet.
Aber viele Lehrerinnen und Lehrer sprechen nicht offen über dieses Thema, weil sie das Ressentiment fürchten, der Grund für den Lärm sei mangelnde pädagogische Kompetenz. Genauso schreiben sich gegenwärtig viele Eltern ihr Scheitern selbst zu, wenn es darum geht, den Medienkonsum ihrer Kinder zu reglementieren; dabei haben sie schlichtweg keine Chance gegen die Produktentwicklungs- und Werbestrategien großer IT-Konzerne. Es ist ja gerade das Geschäftsmodell vieler Firmen, die Begierden der Nutzer so anzutriggern, dass das Virtuelle ihr Dasein bestimmt oder Smartphones als Quasiorgane ins Körperschema integriert werden. Die Nutzer werden nervös, wenn die Geräte nicht in Reichweite sind.
Dass die Hattie-Studie für kleinere Klassen eine eher niedrige Lerneffektstärke ermittelte, kam den Bildungs- und Finanzministerien sehr zupass: So konnte man die Klassengrößen mit ruhigem pädagogischen Gewissen beibehalten. Jedoch zeigt eine genaue Lektüre von John Hatties Buch „VisibleLearning“ [siehe nebenstehende Bücherliste], dass gerade das Thema „Klassengröße“ unbedingt weiter untersucht werden muss. Hattie weist nämlich selbst darauf hin, dass veränderte Lehrmethoden, anderes Feedback-Verhalten, neue Formen der Interaktion, die nur in kleineren Lerngruppen möglich sind, das Lernen fördern können.
Und viele Lehrerinnen und Lehrer haben die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Methoden – wie beispielsweise das von vielen Oberstufenschülerinnen und -schülern immer noch sehr geschätzte lehrerzentrierte Unterrichtsgespräch – nur in Klassen bis maximal 20 Schülern überhaupt funktionieren.
Große Lerngruppen produzieren quantitativ mehr Arbeit als kleine. Das wäre an sich vielleicht eine lapidare Aussage, wenn sich nicht die Benotungskriterien und – damit eng verbunden – die sogenannte Schreibkompetenz, also die Fähigkeit, lesbare Texte zu schreiben, so gravierend verändert hätten. Oberstufenklausuren mit 10 bis 15 Rechtschreib- und Grammatikfehlern pro Seite sind leider nicht die Ausnahme; und für einige Handschriften benötigt man Werkstattleuchten und Leselupen.
Für Lehrerinnen und Lehrer heißt das aber, dass die Klausurenkorrektur durchschnittlich länger dauert als früher, dass jede Klausur mindestens zwei Mal gelesen werden muss: Zunächst müssen die Orthographie-, Grammatik- und Ausdrucksfehler analysiert und markiert werden, dann die – oft durch die Fehler produzierten – semantischen Unverständlichkeiten.
Aufgefordert, Lehrerarbeitszeiten transparent zu machen, veranschlagt der Berliner Senat 20 bis 25 Minuten Korrekturzeit für eine Oberstufenklausur inklusive der Beurteilung durch ein elektronisches Bewertungsraster. Dieses sogenannte Onlinegutachten hat für bestimmte Klausurformate zum Beispiel im Fach Deutsch 12 Bewertungskriterien parat. Je nachdem benötigt man für die endgültige kriteriengeleitete Beurteilung einer einzigen Klausur über 50 Klicks.
Das ist Fließbandarbeit im digitalen Zeitalter: Erst korrigiert man die Klausur mit der Hand, dann klickt man sich durch die Onlineraster, druckt sie aus, unterschreibt und heftet sie an die Klausuren. Das Arbeitszimmer muss für solche Abläufe optimiert werden. Im Kreis läuft man so oder so … und die veranschlagte Arbeitszeit wird immer überschritten. Weil es nicht zu schaffen ist. Unter 45 Minuten kann man keine Deutsch- oder Philosophie-Klausur korrigieren, wenn man der Schülerarbeit einigermaßen gerecht werden möchte. So sitzt man dann 15 Stunden (oder länger) an der Korrektur eines einzigen Klausurenstapels.
Sind Oberstufenkurse im Allgemeinen kleiner als die der Mittelstufe, so können sich die Mittelstufenlehrerinnen und -lehrer zwar damit trösten, dass die zu korrigierenden Texte nicht so lang sind; aber es sind eben mehr (und meistens enthalten sie mehr Fehler). Schlimm wird es für Kolleginnen und Kollegen, deren Fächer nur zwei Stunden pro Woche unterrichtet werden. So kann es sein, dass eine Ethik- und Biologielehrerin in der Mittelstufe vier Klassen in beiden Fächern unterrichtet. Geht man davon aus, dass sie pro Halbjahr zwei Lernerfolgskontrollen (LEKs) schreiben lässt, allein um die Zeugnisnote valide abzusichern, so sind das 8 mal 4 mal 30 LEKs, die korrigiert werden müssen. In der Summe: 960 Arbeiten. Geht man von Sekundarschul-Klassen mit 25 Schülern aus, so sind es immer noch 800 LEKs. Stückzahlen, die korrigiert werden müssen.
Da aber jede Vollzeit-Lehrkraft noch weitere 9 oder 10 Stunden unterrichtet, kommen weitere Korrekturbelastungen hinzu. Und damit sind viele andere Arbeiten wie digitale Fehlzeitenverwaltung, das Anfertigen von Abiturentwürfen für das dezentrale Abitur (zum Beispiel im Fach Philosophie) oder vermehrte Prüfungsaufgaben noch gar nicht berührt.
Auch führt die Kompetenzorientierung dazu, dass mittlerweile gerade junge Lehrerinnen und Lehrer digital verwaltete Notenarsenale anlegen; denn die Kompetenzideologie fordert, dass ein Schüler differenziert nach unterschiedlichen Kompetenzen bewertet wird. Erteilt man einem Schüler oder einer Schülerin drei Mal pro Schulhalbjahr jeweils fünf oder sogar mehr Kompetenznoten für die Mitarbeit im Unterricht, so heißt das, dass ein Lehrer mit vollem Stundendeputat – in Berlin sind das 26 Unterrichtsstunden – im ganzen Schuljahr weit über 5000 Noten gibt; unterrichtet er vor allem zweistündige Fächer, so erhöht sich die Zahl schnell auf 6000 bis 7000 Noten pro Schuljahr. Man muss sich solche Zahlen vor Augen führen, um die Absurdität der kompetenzorientierten Benotung zu erkennen.
Als Lehrer ist man gegenwärtig die meiste Zeit am Rechnen, und zwar vor allem mit dem vergeblichen Versuch, seine Arbeitsbelastung zu reduzieren. Denn die Reaktion der Bildungsverwaltungen ist: Lehrerinnen und Lehrer müssen ihr Zeitmanagement verbessern. Es ist die für neoliberale Gesellschaften typische Forderung an das erschöpfte Selbst: Wenn du deine Arbeit nicht schaffst, musst du deine Abläufe optimieren. Es liegt an dir! Der Zynismus geht mittlerweile so weit, dass Lehrerinnen und Lehrern von externen Evaluationsbehörden empfohlen wird, in ihrer Freizeit, die es ja kaum noch gibt, „Wohlfühlteams“ zu bilden oder Workshops zur „Work-Life-Balance“ zu buchen.
Es mag paradox klingen, dass die so gehypte Neue Lernkultur entfremdete Arbeit und Lärm erzeugt; doch machen eben diese Zustände die technokratisch-metrische Grundstruktur der Kompetenz-Modellierung nun auch für diejenigen sichtbar, die sie bisher fetischisierten. Und auch den neoliberalen Selbstoptimierungsimperativ sollte man als das durchschauen, was er ist: eine Ausbeutungsstrategie. Vor allem aber führt die neue Unterrichtstechnokratie dazu, dass Bildung nur noch unter dem Aspekt der Operationalisierung und Messbarkeit betrachtet wird; deshalb spricht der Wiener Philosoph Konrad Paul Liessmann von der „Praxis der Unbildung“ [siehe Bücherliste].
Würden Klassen verkleinert, würde man sich vom Metrisierungswahn, der Output-Orientierung und vom Diktat des kooperativen Lernens abkehren, so würden sich Korrekturpensen, Lärm und Stress enorm verringern; und es gäbe mehr Zeit für schöpferische und zwischenmenschliche pädagogische Aufgaben – vor allem für eigenständige Unterrichtsgestaltung.
Zumindest was den Korrekturaufwand betrifft, produziert die Neue Lernkultur einen – leider sehr zweifelhaften – Kollateralnutzen: Da die Bildungsverwaltungen die Bedeutung von Orthographie und Grammatikfehlern für die Gesamtnote einer Klausur immer weiter marginalisieren, schleicht sich sowieso schon bei manchem Lehrer eine resignative Laxheit ein. Man streicht gar nicht mehr alle Fehler an. Das spart Zeit! – führt aber dazu, dass viele Schülerinnen und Schüler die Fehlerhaftigkeit ihrer Klausuren gar nicht mehr erkennen können. Und viele von ihnen werden später selbst Lehrerinnen und Lehrer … Auch hier gilt: Die Masse macht’s.
aus: Frankfurter Rundschau vom 12./13.01.2019, S.21
Dieser Beitrag erscheint mit freundlicher Genehmigung des Autors auf Schulforum-Berlin.