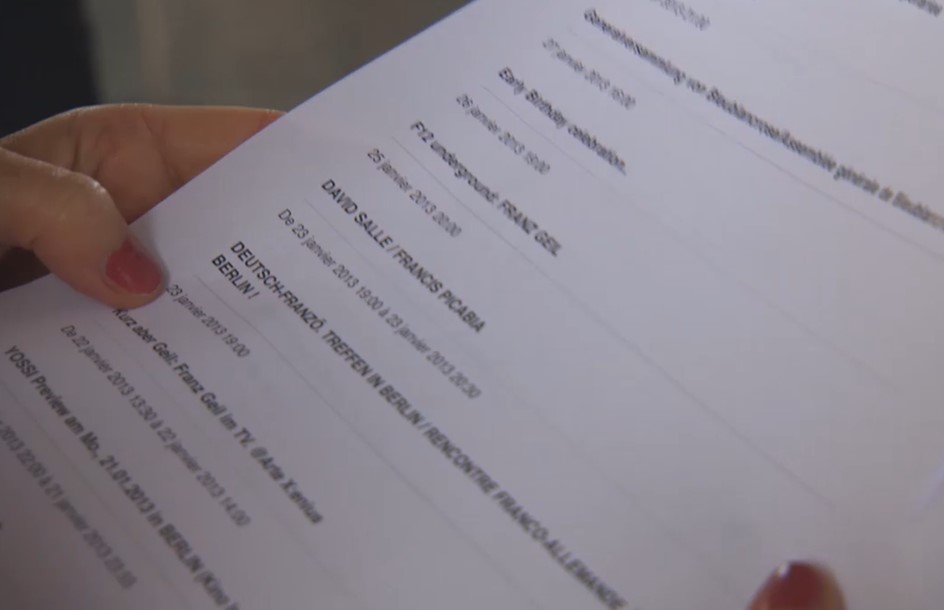Für das Zeitungs- und Schulprojekt „Gesund und sicher“ untersuchten Jugendliche des Wald-Gymnasiums, Berlin-Westend, wie viel Zeit Schüler am Handy und mit Sport verbringen.
An diesem Text und dem Projekt haben mitgearbeitet: Thea Ossenberg, Leo Boberg, Annie List, Julian Draenkow, Gregor Radtke, Jannis Stöwer, Fiona Christmann, Vivien Meggyes, Elisabeth Fenniger, Hannah-Marla Stein, Jonas Vlachy, Linus Gentz.
Tagesspiegel, 10.03.2020
„Gesund und sicher“ ist ein medienpädagogisches Projekt, das von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung mit ihren Unfallkassen und Berufsgenossenschaften im Rahmen der Präventionskampagne „kommmitmensch“ initiiert wurde. Schülerinnen und Schüler recherchieren anhand konkreter Beispiele Sicherheits- und Gesundheitsthemen in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen. Bei dem Projekt machen zehn Tageszeitungen in ganz Deutschland mit. Im Tagesspiegel erscheinen auf der Lernenseite Artikel von drei Schülergruppen. In dieser Woche schreiben Jugendliche des Wald-Gymnasiums in Berlin-Westend. Sie haben untersucht, wie viel Zeit Schülerinnen und Schüler für digitale Medien im Vergleich zu sportlichen Aktivitäten aufwenden.
Bei unserem Projekt befassten wir uns ein halbes Jahr lang im Bereich
„körperliche und geistige Gesundheit“ mit der Erfassung und Deutung der Zeit,
die wir Schüler täglich am Handy verbringen, im Vergleich zum täglichen
Sporttreiben. Da gerade diese Themen heutzutage in Familien oft zu
Streitigkeiten führen und die ständige Handy-Nutzung unserer Generation bemängelt
wird, interessierten wir uns vor allem für den Vergleich mit Sport, da dieser,
gerade bei den Jugendlichen, in den letzten Jahren immer weiter in
Vergessenheit geraten und vernachlässigt worden ist. Wir wollten wissen, welche Bedeutung Sport und
digitale Medien an unserer Schule haben und ob es hierbei auch Unterschiede
zwischen den einzelnen Jahrgängen gibt.
Dafür haben wir uns als Zeitungsprojekt AG des
Wald-Gymnasiums Berlin unter der Leitung von unserer Lehrerin Frau Vivien
Meggyes jeden Montag zusammengesetzt und zunächst Ideen für die Untersuchung
und Messung dieser Bereiche gesammelt.
Schüler machen Selbstversuche [siehe nachfolgend die Berichte zweier Schülerinnen]
Gerade weil wir alle Jugendliche sind und die meisten aus unsere Generation schon mit einem Smartphone groß geworden sind, war es für einige ausgeschlossen sich vorzustellen, ein Leben ohne Handy zu führen. Das brachte uns dann relativ schnell auf unsere erste Idee zum Thema Smartphone-Nutzung. Diese betraf die Durchführung eines Selbstexperimentes. Jeder der zwölf Teilnehmer steckte sich hierbei eigene Ziele, damit wir eine große Vielfalt an Erkenntnissen sammeln konnten. Es wurde das Sporttreiben verdoppelt, die Handy-Nutzung reduziert und letztendlich auch ganz auf das elektronische Gerät verzichtet. Dies alles geschah in einem Zeitraum von zehn Tagen, in denen wir unsere Erfahrungen dokumentierten.
Nach den Herbstferien, beim gemeinsamen Besprechen unserer
Experimente, stellten wir fest, dass nur acht von uns die Herausforderung
angenommen hatten. Andere hatten das Experiment nur zum Teil durchgeführt oder
meinten, dass sie eh schon wenig Zeit am Telefon verbringen würden. Und auch
das Sporttreiben blieb bei einigen auf der Strecke. Eine von uns hatte das
Experiment lustigerweise umgedreht und so viel Zeit sie aushielt am Handy
verbracht.
Zum einen hat sich bei den Experimenten herausgestellt, dass man in seinen Tätigkeiten
ohne Handy oftmals eingeschränkt ist. Alltäglich organisatorische Dinge,
wie zum Beispiel Kommunikation, Wegfindung und Absprachen mit Familie und
Freunden waren beschwerlich. Ständig hatte man Ängste, man könne etwas
Wichtiges verpassen, weil man die „Reminder“ gewöhnt ist. Viele fühlten sich
von der Welt abgeschnitten. Ohne ein Smartphone war man auf einmal ein
Außenseiter, und für Außenstehende war dieses Verhalten nur schwer zu
verstehen. Das größte
Problem lag jedoch bei den meisten an der plötzlich auftretenden Langeweile,
die viele von uns ohne Handy überkam. Freizeit ist ein Privileg, nachdem sich viele Menschen
sehnen, doch ohne Handy hatte man auf einmal viel zu viel von ihr. Es fehlte
uns an der Kunst der Selbstbeschäftigung, die wir, wie wir feststellen mussten,
mit den Jahren an unsere Smartphones verloren hatten.
Doch auch bei dem Experiment, bei dem es um viel Handy-Benutzung ging, haben wir erschreckende Erfahrungen machen müssen. Hierzu zählte sowohl die entstehende Ungleichheit in der Kommunikation mit dem Umfeld, als auch das Auftreten gesundheitlicher Probleme. Auch hier führte die übertriebene Handy-Nutzung zur Vernachlässigung des Umfeldes. Durch die mitunter 15-stündige Handy-Nutzung am Tag wurde die Welt um einen herum ausgeblendet. Teil des eigenen Lebens, geschweige denn eines gemeinsamen Familienlebens, war man lange nicht mehr.
Jedes
Experiment half dabei, uns besser mit unserem Thema identifizieren zu können.
Es war eine Bereicherung für das Projekt, aber auch für uns persönlich, da wir
merkten, dass auch ein Leben ohne Smartphone möglich ist und viel zu bieten
hat.
Mit einem Fragebogen Sport und Medienkonsum vergleichen
Bei unserer zweiten Idee handelte es sich um eine Umfrage, mit
Hilfe eines Fragebogens, der sich speziell auf den Vergleich Sport- und
Medienkonsum bezog. Wir interessierten uns vor allem für den Vergleich zwischen
den jeweiligen Klassenstufen, da wir davon ausgingen, dass es, trotz geringen
Altersunterschieden, Unterschiede in der Handy-Benutzung und den
Sporttätigkeiten geben würde. Hierfür befragten wir rund 430 Schüler unseres Gymnasiums,
aus den Klassenstufen sieben bis zehn. Besonders fiel uns auf, dass wir viel Zuspruch von den Lehrern
erhielten, die sich extra Zeit nahmen, damit unsere Umfragen beantwortet
werden konnten. Daran konnten wir erkennen, dass unsere Lehrer dieses Thema
auch als sehr wertvoll empfinden.
Ebenso wurden wir bei den Auswertungen überrascht. Je älter die Schüler waren,
desto mehr Zeit verbrachten sie täglich am Handy. Nicht etwa um zu lernen oder
zu kommunizieren, am meisten Zeit ging für die sozialen Medien drauf, die der
Unterhaltung dienten. Es bestätigte sich unsere beim Selbstexperiment gemachte
Erfahrung, dass das Handy fast nur genutzt wird, um die eigene Langeweile zu
bekämpfen. Auch witzig anzusehen waren die Fehleinschätzungen der
Schüler, die raten sollten, wie viel Zeit sie täglich am Handy verbringen.
Danach durften sie – von den Lehrern erlaubt – ihre richtige Bildschirmzeit
nachschauen und stellten alle voller Überraschung fest, dass es doch ein paar
mehr Stunden am Handy waren als gedacht.
In Klasse sieben und acht treiben erstaunlich viele
Schüler Sport
Trotz dieser Ergebnisse ließ sich im Hinblick auf sportliche
Aktivitäten sagen, dass in den Klassenstufen sieben und acht erstaunlich viele
Schüler regelmäßig Sport trieben. Mit dem Alter sanken natürliche auch diese
Werte. Hierbei fiel auf, dass so gut wie kein Sport mehr in der Schule
getrieben wurde. Bis auf den Schulsport und Schulwettkämpfe interessierten sich
viele der Schüler nicht dafür, sich auch in den Pausen sportlich zu betätigen,
ausgenommen die Fußballfanatiker unter uns. Interessant wäre es hier, mal
Berlin weit zu schauen, ob es an anderen Schulen ähnlich zugeht.
Sowohl die Experimente als auch unsere Umfragen zeigten,
dass das Handy in unserer Generation einen hohen Stellenwert hat und aus dem
Leben der Jugendlichen nicht mehr wegzudenken ist. Dass das doch so wichtige Sporttreiben
immer weiter in den Hintergrund rutscht, wird von den meisten gekonnt ignoriert. Heutzutage
gelten andere Prioritäten, wie zum Beispiel gute Kontakte oder eine hohe Follower-Zahl. Doch
bedeutet das, dass wir uns in unserem Leben nach unserem Smartphone richten
sollten? Können wir noch weiterhin frei entscheiden, was wir gerne tun wollen
und was nicht?
Die Untersuchung: Infos und Ergebnisse
An der Untersuchung „Digitale Medien vs. Sporttreiben an der
Schule“ haben sich 445 Schüler des Wald-Gymnasiums beteiligt aus den 7. bis 10.
Jahrgängen mit jeweils vier Klassen pro Jahrgang. Wir haben die Umfrage mit
Hilfe eines selbst erstellten Fragebogens durchgeführt und unsere eigenen
Beobachtungen in unserer Zeitungsprojekt AG mit Frau Meggyes später ausgewertet
und diskutiert. Die Fragen bezogen sich auf den Zeitpunkt vom Erhalt des ersten
Handys und deren Gründe sowie deren Verwendungsart und die
Freizeitgestaltung bevor die Schüler ihr erstes Telefon bekamen. Im Bezug auf
Sport wurden Zeitrahmen und Sportarten sowie Pausenverhalten im Bezug auf
Sporttreiben an unserer Schule erfragt.
Mitunter mussten sich unsere Gymnasiasten der Frage stellen, wie viel Zeit sie in der Woche mit „Digitalen Medien“ auf ihren Smartphones verbringen und wie lange sie im Gegenzug in ihrer Freizeit Sport treiben. Ersteres für die „Bildschirmzeit“ ist mit Hilfe einer App am Telefon erfassbar, manche Telefone haben diese Funktion integriert. Interessant war die Beobachtung, dass die meisten Schüler ihre Bildschirmzeit um circa 10 Prozent unterschätzten. Mit dem Alter steigt der Medienkonsum. Während der durchschnittliche Siebtklässler „nur“ 18,48 Stunden die Woche am Handy verbringt, benutzt der durchschnittliche Zehntklässler 29,35 Stunden Digitale Medien an unserer Schule. Der hohe Anstieg der Mediennutzung könnte mitunter daran liegen, dass viele Schüler mit dem Alter ihre Smartphones nicht nur zum Zeitvertreib, sondern auch für Recherchen benutzen. Beim genaueren Nachfragen haben wir mitbekommen, dass digitale Medien benutzt werden, um sich über Themen zu informieren, Referate vorzubereiten und auch Hausaufgaben zu erledigen. Dennoch wird das Sporttreiben bei den Schülern in allen Klassenstufen vernachlässigt. Dies kann man deutlich bei allen Klassenstufen insbesondere jedoch an dem 9. Jahrgang erkennen. In dieser Klassenstufe wird durchschnittlich nur 1,43 Stunden die Woche Sport getrieben abgesehen vom Schulsport. Das ist eindeutig zu wenig. Das regelmäßige Sporttreiben ist wichtig, denn Körper und Geist brauchen dieses, um uns junge Menschen gesund zu halten und einen Ausgleich für die Schule zu bieten. Des Weiteren haben wir mitunter in der Umfrage erfasst, wann die Schüler ihr erstes Smartphone bekommen haben. Während 8 Prozent der befragten Zehntklässler ihr Handy nach der sechsten Klasse bekommen hatten, hatten die befragten Achtklässler alle ihr Handy schon bis zur 6. Klasse erhalten. Immer wieder sieht man kleinere Kinder mit ihren Smartphones durch die Gegend laufen.
zum Artikel im Tagesspiegel über das Projekt „Gesund und sicher“ – Schüler unterschätzen ihre Bildschirmzeit
Für Teenager unvorstellbar: Eine Woche ohne Smartphone
Für das Zeitungs- und Schulprojekt „Gesund und sicher“ hat die Schülerin Annie List des Wald-Gymnasiums, Berlin-Charlottenburg, eine Woche auf ihr Handy verzichtet. Hier ihr Bericht:
Eine Woche ohne Smartphone – für viele Teenager ist das eine unvorstellbare Situation. Auch ich nutze mein Handy viele Stunden am Tag. Es ist fest in den Alltag eingebunden und gehört zum Leben. Man ist gewissermaßen abhängig von diesem Gerät. Ob man Freunde kontaktieren, das Wetter oder auch nur die Uhrzeit checken möchte, das Handy steht immer zur Verfügung. Doch was passiert, wenn das Smartphone mal nicht zur Stelle ist? In einem Experiment will ich herausfinden, wie sich mein Alltag ohne Smartphone-Nutzung verändert. Deshalb lege ich mein Handy eine Woche zur Seite. Um zu widerstehen, kommt das Handy in eine Box, die zugeklebt wird. Und dann geht es auch schon los.
Gleich am ersten Tag fällt mir auf, dass ich erst meine Schulaufgaben und Hausarbeiten erledige, bevor ich mich ausruhe. Normalerweise wäre ich nach Hause gekommen und hätte erst einmal ein bis zwei Stunden am Handy gesessen. Nun lasse ich mir für alles mehr Zeit und arbeite ordentlicher. Ich benutze meine Armbanduhr, und um Musik zu hören, schalte ich das Radio ein. Ich erledige Dinge, die ich sonst vor mir hergeschoben hätte. Bis zu dem Punkt, an dem ich nichts mehr zu tun habe.
Was fängt man mit der freien Zeit an?
Wahrscheinlich gibt es tausend Dinge, die man machen könnte, doch mir fehlen die Ideen. Ich weiß nicht, wie ich mich beschäftigen soll, und schnell wird mir langweilig. Ich war nie wirklich kreativ, aber man sollte doch wissen, was man mit seiner freien Zeit anfängt? Dieses Problem hat sonst immer mein Smartphone behoben. Ich frage mich, wann mein Handy angefangen hat, mein Leben zu gestalten.
In den nächsten Tagen bestätigt sich mein Eindruck. Man braucht kein Social Media, doch gerade in der Schulzeit fehlt das Handy, um auch mal etwas zu googeln. Ich schaue viel Netflix, um die Langeweile etwas zu bekämpfen, was im Endeffekt ja auch nicht viel besser als Youtube & Co ist. An den Abenden verbringe ich mehr Zeit mit meiner Familie und gehe eher schlafen.
In der Mitte der Woche ist Ferienbeginn, und ich packe den ganzen Tag meine Taschen, um zu verreisen. Meine eigene Musik fehlt mir dabei sehr. Als ich bei meinen Großeltern ankomme, fühle ich mich sehr wohl ohne Handy, da ich so der Familie mehr Zeit widmen kann. Auch hier merke ich, dass mein Experiment viel Aufsehen erregt. Ich denke nicht viel über mein Handy nach, bis ich ständig auf das Thema angesprochen werde. Heutzutage ist es außergewöhnlich, kein Handy zu besitzen, was ich schockierend finde, wenn ich länger darüber nachdenke.
Am letzten Tag ohne Smartphone bin ich mir sicher, dass ich noch weitermachen könnte, doch ich weiß genau, dass ich gleich am nächsten Morgen mein Handy wieder benutzen werde. Der Gedanke stört mich, doch die Neugier gewinnt. Ich will unbedingt wissen, was ich in der Zeit, als ich offline war, verpasst habe. Als es dann so weit ist, schaffe ich es genau bis zum Frühstück. Danach schalte ich mein Handy wieder ein, und wie zu erwarten habe ich nichts Wichtiges verpasst. Ich genieße es, spontan erreichbar zu sein und auf Musik zugreifen zu können, aber für den restlichen Tag nehme ich mein Handy nirgends mit hin.
Wie es nach dem Experiment weitergeht
Nach dem Experiment kann ich meine Handynutzung noch eine Weile stark einschränken. Es wird erst wieder mehr, als mir langweilig ist. Jetzt benutze ich mein Smartphone genauso häufig wie vor dem Experiment. Mir fällt auf, dass ich es fast nur dann benutze, wenn mir langweilig ist. Wenn ich lernen würde, meine Zeit produktiv zu nutzen, könnte ich mein Smartphone-Verhalten stark eingrenzen. Das Handy ist nicht notwendig, aber situationsbedingt vereinfacht es das Leben sehr. Ich werde in Zukunft probieren, es öfter mal zur Seite zu legen.
„Ich wollte schauen, was bei einem übertriebenen Handykonsum passiert“
Die Schülerin Hannah-Marla Stein, Wald-Gymnasium, Berlin-Charlottenburg, hat im Rahmen des Projekts „Gesund und sicher“ ein paar Tage lang so viel Zeit wie möglich am Handy verbracht. Ein Interview:
Welchen Herausforderungen hast du dich bei unserem Selbstexperiment gestellt?
Ich habe mir vorgenommen genau das Gegenteil von dem zu machen, was unsere Lehrerin, Frau Meggyes, ursprünglich vorgeschlagen hat. So kam mir die Idee, dass es viel spannender wäre zu sehen, was passieren wird, wenn ich extrem viel Zeit an meinem Handy verbringe.
Wie lange warst du insgesamt am Handy?
Ich habe während meines Selbstexperimentes in den Ferien ganze 15 Stunden am Handy verbracht.
Womit hast du dich an deinem Handy am meisten beschäftigt?
Am Anfang war ich zunächst in den sozialen Netzwerken unterwegs, wie zum Beispiel auf Instagram und habe geschaut, welche Fotos meine Freunde gepostet haben. Irgendwann jedoch habe ich alle neuen Beiträge gesehen. Die meiste Zeit habe ich dann mit Netflix verbracht. Dort habe ich einige Filme und Serien angeschaut.
Betrachtest du dein Experiment als gelungen?
Ich habe mein Vorhaben nur für einen kurzen Zeitraum von drei Tagen durchgehalten. Danach haben sich die ersten Probleme bemerkbar gemacht, und ich musste das Experiment abbrechen.
Inwiefern ist es dir schwer gefallen so viel Zeit am Handy zu sein?
Schwer fiel es mir am Anfang nicht, da ich auch ohne Experiment viel am Handy bin. Schnell habe ich jedoch bemerkt, dass es nach einer Weile ziemlich langweilig wird.
Hast du irgendwelche Beschwerden bemerkt, nachdem du so viel Zeit am Handy verbracht hast?
Nach den ersten acht Stunden machten sich die ersten Anzeichen bemerkbar: meine Augen fingen an weh zu tun. Nach etwa zehn Stunden bekam ich zunehmend Kopfschmerzen, aber ich wollte mein Vorhaben nicht aufgeben.
Die Kopfschmerzen wurden dann immer schlimmer und schlimmer. Als ich schon am ersten Tag 15 Stunden an meinem Handy war, musste ich das Experiment in der Form abbrechen. An den folgenden Tagen war ich dann noch 3 bis 4 Stunden am Telefon. Ich hatte extrem starke Kopfschmerzen und meine Augen fühlten sich trocken und voller Druck an. Es machten sich aber nicht nur körperliche Erscheinungen bemerkbar; Meine Laune wurde immer schlechter und ich wurde immer gereizter, je länger ich das Experiment durchgeführt habe. Auch habe ich mich um nichts und niemanden mehr gekümmert um mich herum.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du so viel am Handy warst?
Zunächst fanden sie die Idee gut, da es sie auch interessierte, ob sich Beschwerden bemerkbar machten. Meine Eltern fing es jedoch schnell zu nerven an, weil ich sozusagen in meiner eigenen Welt und nicht wirklich ansprechbar war. Ich habe sogar Kopfhörer aufgesetzt, um nicht einmal ihre Stimme wahrzunehmen.
Was hast du aus deinem Experiment gelernt?
Auf jeden Fall werde ich meinen Handykonsum in Zukunft erheblich einschränken und ich finde das sollten wir alle tun, da ich erlebt habe, dass es tatsächlich körperliche Schäden verursacht. Auch wenn man es selbst nicht als gefährlich wahrnimmt, bin ich mir jetzt sicher, dass eine hohe Bildschirmzeitzeit zu Langzeitschäden führt.
Das Interview führte Fiona Christmann.