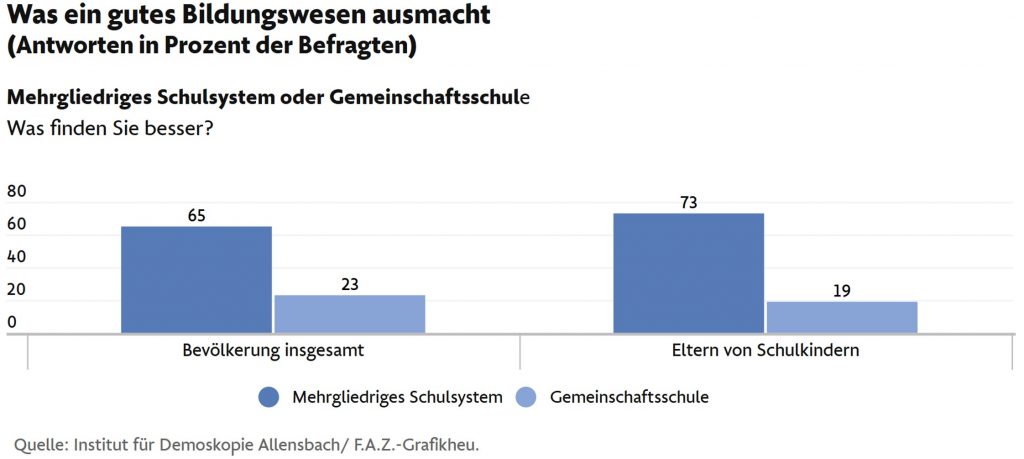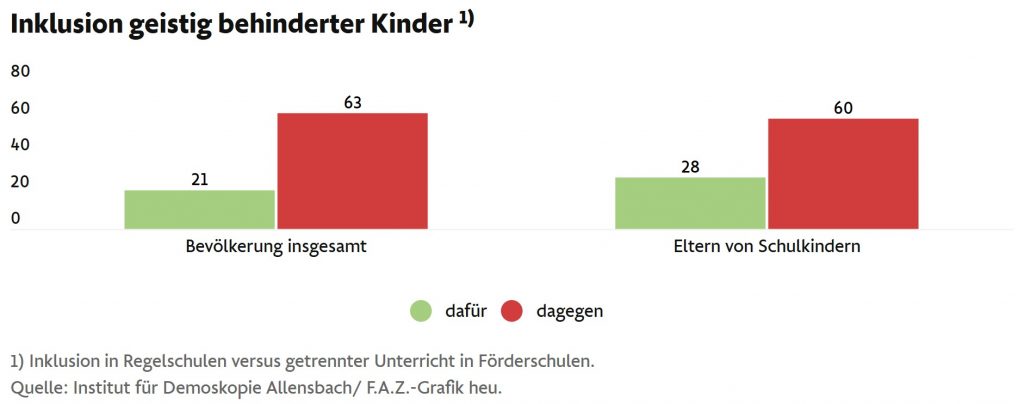„Kinder werden systematisch in die Irre geführt“
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.7.2019, Karlheinz Wagner und Michael Hesse im Gespräch mit Prof. Una Röhr-Sendlmeier.
Es spricht für die Brisanz des Themas, wenn sich an einem lauen Frühsommerabend 150 oder mehr Menschen – Pädagogen, Gewerkschafter, Eltern – zu einem Vortrag in die Aula des Irmgardis Gymnasiums von Köln-Bayenthal hocken. „Schraim nach Gehöa“ hatten Prof. Una Röhr-Sendlmeier von der Uni Bonn und ihr Doktorand Tobias Kuhl den Abend orthografisch angemessen keck benannt, denn um „Wege und Irrwege im Rechtschreibunterricht“ sollte es ja gehen. Die Wissenschaftler stellten ihre Studie vor; sie hatten untersucht, nach welchen Methoden und mit welchem Erfolg Grundschüler in NRW Schreiben und Lesen lernen. Die Ergebnisse – die Mehrzahl der Kinder lernt Orthografie nicht oder nicht hinreichend gut – hatten die Zuhörer geahnt; dennoch herrschte am Ende im Auditorium eine Form von zorniger Ratlosigkeit: Warum werden Schüler nach Methoden unterrichtet, die im Ergebnis nicht funktionieren?
Frau Röhr-Sendlmeier, eine Frage zum Beginn der Ferien: Was wird sich im nächsten Schuljahr ändern – immerhin hat die NRW-Landesregierung eine Neuausrichtung zum Thema Rechtschreib-Unterricht angeordnet?
Wenn – wie die Ministerin sagt – Fehler von Anfang an korrigiert werden sollen, wenn die Kinder einen verbindlichen Mindestwortschatz erwerben und wenn die Regeln der Schriftsprache vermittelt werden sollen – dann sind das drei wichtige Säulen, die man nur begrüßen kann. Wenn aber gesagt wird, dass der Ansatz „Lesen durch Schreiben“ weiterhin im Anfangsunterricht möglich sein soll, dann ist Vorsicht geboten. Bei systematischem Unterricht kann man Anlauttabellen als Zusatzmaterial anbieten. Man darf die Kinder aber nicht in dem Glauben lassen, sie könnten sich die Rechtschreibung über die Anlauttabelle selbst erschließen. Und es muss freundlich korrigiert werden von Personen, die die Orthografie beherrschen, damit sich die Kinder nichts Falsches einprägen.
Wollen Sie die unterschiedlichen Methoden noch einmal skizzieren?
Wir haben drei didaktische Ansätze untersucht.
1. Fibel-Unterricht: Dabei spielen die Lehrer als Wissensvermittler eine zentrale Rolle, es wird geübt und das Geschriebene korrigiert. Der Unterricht ist strukturiert nach den Prinzipien der Schriftsprache – es geht vom Einfachen zum Schwierigen; vom Häufigen zum Seltenen.
2. Rechtschreib-Werkstatt: Es gibt Arbeitsblätter und Kärtchen für Abschreibübungen, die die Kinder selbst auswählen. Der Lehrer hat eine beratende Rolle, er korrigiert nicht; die Kinder sollen sich selbst korrigieren und mit dem Material selber das Schreiben beibringen. Gelernt wird unter anderem mit der Anlaut-Tabelle.
3. Lesen durch Schreiben (oder: Schreiben nach Gehör): Der Lehrer gibt Anregungen zum Schreiben mit Hilfe der Anlauttabelle. Es soll motiviert, nicht korrigiert werden; die Kinder legen Stoff und Lerntempo selbst fest – sie managen ihren Orthografie-Unterricht selbst.
Zu diesem Themenbereich haben Sie eine Studie veranlasst. Was war der Grund?
Die Rektorin einer Grundschule aus NRW ist auf mich zugekommen mit der Beobachtung, dass ihre Schüler am Ende des 4. Schuljahres nicht korrekt schreiben können. Und sie fragte, welche Didaktik sie an ihrer Schule einsetzen solle. Ohne eine breitangelegte und methodisch sauber durchgeführte Studie konnte ich keine Antwort geben.
Wie sind Sie vorgegangen?
Begonnen haben wir in der Schule, deren Rektorin mich damals angesprochen hatte. Es sind dann elf weitere Schulen hinzugekommen – insgesamt haben wir über drei Jahre hinweg bei denselben 284 Schülern von Schulbeginn an die Entwicklung der Rechtschreibung nach einem gesicherten Verfahren gemessen: nach der Einschulung und dann jedes schulische Halbjahr – insgesamt also fünfmal. Das ist eine sogenannte Längsschnittstudie. Zusätzlich haben wir von 2800 Kindern der Klassen eins bis vier jeweils zum Ende der Schulhalbjahre die Rechtschreibkenntnisse erfasst.
Wie waren die Ergebnisse?
In beiden Teilstudien waren die Ergebnisse der Kinder mit Fibel-Unterricht signifikant besser als bei den Kindern, die nach Lesen durch Schreiben oder Rechtschreibwerkstatt gelernt hatten. In der Längsschnittstudie konnten wir auch die Vorkenntnisse der Schüler erfassen – denn es ist wichtig, ob Kinder zum Beispiel schon Buchstaben kennen. Diese Vorkenntnisse wurden in der Auswertung berücksichtigt und nur die Lernzuwächse der Schüler verglichen. Das Ergebnis: 1. Kinder, die strukturiert nach einer Fibel lernen, erreichen in ihren Rechtschreibleistungen mindestens ein durchschnittliches bis überdurchschnittliches Niveau; nur wenige Kinder lernen nicht gut schreiben, aber auch das auf einem relativ moderaten Niveau. 2. Kinder, die nach einer der freien Methoden lernen, erreichen vielfach nicht ein mittleres Niveau, sondern schreiben unterdurchschnittlich. Es gibt allerdings auch bei den freien Methoden Kinder, die gute und sehr gute Leistungen zeigen.
Woran liegt das?
Man kann fragen, ob das auch an der Unterstützung liegt, die diese Schüler vom Elternhaus erfahren. Die Kinder, die Schulen mit der „Lesen durch Schreiben“-Methode besuchten, hatten signifikant höhere Vorkenntnisse. Dies ist ein Hinweis auf bildungsnähere Familien. Recht neu ist zudem das Phänomen, dass Schüler in großer Zahl in Nachhilfe-Institute gehen, um die Orthografie zu lernen, damit Rechtschreibdefizite, die durch die freien Methoden entstehen, ausgeglichen werden.
Hat Sie das Ergebnis überrascht?
Nun, das Lernen mit Anlaut-Tabellen suggeriert, man könne sich mit einer solchen Abbildung sämtliche Realisierungen von Wörtern erschließen. Dabei enthalten die Tabellen viel zu starke Vereinfachungen. Der Buchstabe E ist etwa illustriert mit einem Esel – da entspricht der Laut tatsächlich dem Namen des Buchstabens. Aber es ist auch eine Ente abgebildet, und das E von Ente ist ein anderer Laut als das E des Esels. Oder: Für das I wird ein Igel gezeigt. Das lange I wird aber in 72 Prozent der Fälle mit „ie“ geschrieben. Die Kinder werden systematisch in die Irre geführt. Man soll dadurch, dass man viel schreibt, lesen lernen. Das ist Unsinn, denn die Prozesse sind lernpsychologisch sehr verschieden. Es wird den Kindern gesagt: Schreib, wie du sprichst. Und weil kein Kind genau weiß, wie es spricht, wurde das abgewandelt: Schreib auf, was du hörst. Die Kinder sollen die Laute, die sie beim Vorsprechen hören, in der Anlauttabelle suchen und die entsprechenden Buchstaben aufschreiben.
Aber Deutsch wird eigentlich nicht geschrieben, wie man es spricht…
Es gibt nur relativ wenige Eins-zu-eins-Entsprechungen zwischen Lauten und Buchstaben. Wir haben Buchstaben, die unterschiedlichen Lauten zugeordnet werden – wie bei Ente und Esel – und wir haben Laute, die verschiedenen Buchstaben zugeordnet sind. Ein gutes Beispiel ist der Laut K, den wir in folgenden Schreibweisen finden: Krokodil, Computer, Qualle, Stück, Fuchs, Weg, Akku, macchiato… Es ist einfach falsch, wenn man den Kindern suggeriert: Ihr könnt euch die Schriftsprache durch Hören und richtiges Sprechen selbst erschließen.
In Ihrem Vortrag haben Sie erläutert, dass sich eine Alphabetschrift nicht von alleine entwickelt; Schriftsprache sei eine kulturelle Errungenschaft, nicht Ergebnis eines biologischen Prozesses…
Das gilt für die Schriftsprache, ja. Die mündliche Sprachfähigkeit ist uns angeboren und biologisch verankert – Kinder können schon vor der Geburt die sprachlichen Laute ihrer natürlichen Umgebung unterscheiden von anderen Geräuschen – bald nach der Geburt versucht das Kind, die sprachlichen Laute seiner Umgebung zu imitieren. Aber die Schriftsprache ist ein ganz anderer Fall; sie ist eine besondere kulturelle Errungenschaft; es gibt viele Kulturen, die gar keine Schrift entwickelt haben, oder Bilderschriften, die keine Hinweise auf die Lautung enthalten. Die Idee, die enorme Abstraktionsleistung, Einzellaute mit Symbolen in Beziehung zu setzen, ist gar nicht sehr alt; erste Zeugnisse deuten auf eine Entstehung etwa 2000 v. Chr. hin; sie entstanden zunächst parallel zu den ägyptischen Hieroglyphen.
Wie konnten sich diese freien Didaktik-Modelle denn gegen den strukturierten Unterricht so flächendeckend durchsetzen?
Nun, der Zugang über eine Anlaut-Tabelle wurde als neue Idee in den 80er Jahren propagiert – von dem Schweizer Jürgen Reichen. Er wollte alles Bürgerliche abschaffen und eine völlig freie Entfaltung auch für Kinder verwirklichen. Systematische Vermittlung von Strukturen und Korrekturen – das sei nicht gut, befand er. Wörtlich: „Je weniger ein Kind belehrt wird, umso mehr lernt es.“ Das war eine ideologische Vorgabe, die in den damaligen Zeitgeist passte.
Wie Reichen dachte, mag auch folgender Ausspruch illustrieren: „Dieser gesamte Rechtschreibwahnsinn führt doch zu nichts anderem, als die Schule mit Quark zu beschäftigen. Dadurch halten wir die Kinder davon ab, wirklich denken zu lernen und uns mit der Welt und dem Leben auseinanderzusetzen“. Auch er hing der Ideologie an, dass Rechtschreibregeln einzig und allein als Herrschaftsinstrument anzusehen seien. „Varat“-Fahren – Rechtschreibung in der Grundschule, von Heike Schmoll, Sendung: SWR 2, Aula, Sonntag, 28.08.2016, Redaktion: Ralf Caspary
Wenn Sie den gesellschaftlichen Zeitgeist ansprechen – ist die Debatte auch eine politische Auseinandersetzung zwischen einer eher konservativen Auffassung – die Fibel ist ja ein klassisches Bildungswerkzeug – und einer eher linken Methodik?
Ich bin Wissenschaftlerin und möchte Fragen objektiv beantworten. Die nüchterne Frage nach einer hilfreichen Didaktik ist zu einer ideologischen Debatte auf gesellschaftlicher Ebene geworden, leider. Es wird dabei ausgeblendet, dass der moderne Fibel-Unterricht nur wenig zu tun hat mit den traditionellen Fibeln, wo es häufig um langweilige Dinge ging und es keine Differenzierungsmöglichkeiten gab zwischen denen, die etwas langsamer lernen, und denen, die schneller vorankommen. Die Debatte selbst beinhaltet somit eine Schieflage. Es sollte ausschließlich um das Wohl der Kinder gehen und nicht um politische Glaubenssätze.
Wie geht die Politik mit Ihren Erkenntnissen um?
NRW hat ja offensichtlich reagiert… Als wir die Ergebnisse hatten – vor etwa einem Jahr – haben wir sie auf einer Tagung in Dortmund vorgestellt und sie Frau Ministerin Gebauer in Kurzform regelrecht in die Hand gedrückt. In der Folge gab es weitere Fachkonferenzen, und es gab Presseberichte. Danach erreichte uns die Aufforderung, dass man sich im Ministerium doch mal treffen solle. Herr Kuhl hat die Studie vorgestellt, ich habe den Hintergrund dargelegt – es wurde sehr engagiert diskutiert. Eine Woche später hat die Ministerin die veränderten Vorgaben ausgegeben: Mindestwortschatz, Korrekturen und Einführung in die Struktur der deutschen Orthografie.
Gab es weitere Reaktionen?
Wir haben viele Einladungen erhalten, unsere Studie vorzustellen. Und in Brandenburg, Schleswig-Holstein und zwei Schweizer Kantonen darf Lesen durch Schreiben künftig nicht mehr als eigene Didaktik verwendet werden. In Hamburg und Baden-Württemberg gibt es schon länger solche Verbote. Insgesamt haben wir durchaus Gehör gefunden bei der Politik.
Jedoch der Berliner Tagesspiegel vom 31.05.2018, hat folgende Überschrift: Scheeres will „Schreiben nach Gehör“ beibehalten. Für ihr Festhalten an „Schreiben nach Gehör“ nimmt die Bildungssenatorin Prof. i. R. Dr. Jörg Ramseger zu Hilfe. Er schreibt im Geleit des Fachbriefes: „Viele der [im Fachbrief Grundschule Nr.11, Mai 2018] ausgeführten Beispiele und Erläuterungen möchte man auch der Presse und manchen ängstlichen Eltern ans Herz legen, die, aufgescheucht durch manche dramatisch präsentierte Schulleistungsstudie, den Untergang des Abendlandes befürchten, wenn ein Kind auf der ersten Stufe eigener Schreibversuche in Skelettschreibung „Hnt“ statt „Hund“ schreibt, und auch noch befürchten, das arme Kind würde sich diese Fehlschreibung für immer einprägen, wenn sie nicht sofort wegradiert würde. Alles Unsinn, wenn man sich etwas in der Materie auskennt!“ [Berliner Schülerinnen und Schüler sind in den letzten Jahren bei den Schulleistungsstudien (Lesen, Schreiben, Rechnen) kontinuierlich auf den letzten Plätzen.]
Der Vorstand des Grundschulverbandes, darunter die Professoren Jörg Ramseger, Erika Brinkmann und Hans Brügelmann, wehrt sich gegen „populäre Vorurteile“ gegen die Grundschulen – und eine darauf bauende reaktionäre Bildungspolitik. Von „fragwürdigem Dilettantismus und Schaufensterpolitik“ ist in der soeben erschienenen Broschüre „Faktencheck“ die Rede.
Geht es hier „ausschließlich um das Wohl der Kinder“ oder „um politische Glaubenssätze“?
Die Zahl der Einladungen und Anfragen nimmt nicht ab – die Unzufriedenheit ist offenbar groß mit dem Lese-Rechtschreib-Unterricht unserer Kinder.
Der Deutschlehrer, Rainer Werner, schreibt in der Tageszeitung Die Welt am 28.08.2019, dass beim Erlernen der Orthografie durch „Schreiben nach Gehör“ viel Schaden angerichtet wird. Die Schüler werden verwirrt, „weil sie nach zwei Jahren anarchischen Schreibens plötzlich gezwungen waren, sich an die Rechtschreibregeln zu halten. Rechtschreibung ist eine Schlüsselqualifikation für das Lernen in allen Fächern und zudem eine wichtige Denkschulung. Die Schüler einer fragwürdigen Lernmethode auszuliefern, war ein pädagogischer Sündenfall.“ Website des Autors
Agi Schründer-Lenzen, Professorin für Allgemeine Grundschulpädagogik und -didaktik an der Universität Potsdam: Wenn also nach der „Lesen durch Schreiben“-Methode [umgangssprachlich „Schreiben nach Gehör“] mit der Anlauttabelle unterrichtet wird, „dann ist es so, dass die Kinder einen Weg in die Schriftsprache gewiesen bekommen, der grundsätzlich einseitig und auch fehlerhaft ist. Man sollte ihnen vom ersten Tag an das anbieten, was richtig ist“. Damit scheint sie dem 8-jährigen Jan aus der Seele zu sprechen. „Also ich würde sagen, dass man schon anfängt, die Fehler zu korrigieren in der Ersten, weil sonst hat man sich da dran gewöhnt zum Beispiel Blatt hinten nur mit einem t zu schreiben. Da kommt auf einmal jemand in der Zwei und sagt, das ist falsch, und das ist falsch. Da kriegt man irgendwie so ein ganz trauriges Gefühl.“ Aus: Deutschlandfunk, 28.08.2014, Aus Kultur- und Sozialwissenschaften, Streit um die richtige Methode.
Grau unterlegte Einschübe, [Anmerkungen] und Hervorhebungen im Fettdruck durch Schulforum-Berlin.
Link zu den bisherigen Veröffentlichungen der Studie Kuhl/Röhr-Sendlmeier