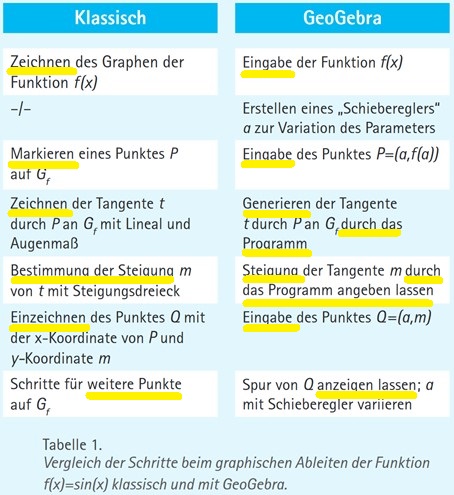Impulsvortrag beim Kongress Armut und Gesundheit, 20. und 21.03.2018, Technische Universität Berlin, Fachforum Nr. 16, „Kinder und Medien“[1]
Im September 2015 initiierte und leitete das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Plattform „Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft“[2]. Wer waren die Teilnehmer? Alle großen IT-Firmen und Verbände[3]: Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom), Telekom[4], Gesellschaft für Informatik[5], Microsoft, SAP[6].
Ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppen lautet: „Die Bildungspolitik muss günstige Rahmenbedingungen für digitale Bildung in Bildungseinrichtungen und Unternehmen[!] schaffen.“[7]
Damit war die IT-Wirtschaft bereits im Boot, bevor pädagogische Fragen geklärt waren.
Ziel der nachfolgenden Kultusministerkonferenz[8] im Dezember 2016 war, „dass möglichst bis 2021 jede Schülerin und jeder Schüler jederzeit, wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist [9], eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen können sollte“. (S. 11)
Zu der bisherigen Umsetzung gibt es jedoch Kritik. Die multimedial gestalteten Lehr-Lern-Umgebungen wie auch eine nachhaltige Infrastruktur werden nicht von den Schülern, vom Unterricht oder vom Lernprozess her gedacht. Das stellen Neurowissenschaftler, Pädagogen, Medienwissenschaftler und Lernpsychologen fest [10], die sich mit den Folgen der Nutzung von Bildschirmmedien bei Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Da stellt sich die Frage:
Warum also der reflexhafte Ruf nach Smartphones, Tablets, Laptops in Schulen und KiTas?
Dazu das Hasso-Plattner-Institut[11]: „Die Schul-Cloud wird dazu beitragen, einen prosperierenden Bildungsmarkt mit innovativen digitalen Bildungsprodukten zu etablieren.“[12]
Was dort nicht steht: Schule und Unterricht werden dabei abhängig von der technischen Infrastruktur. Programme und Nutzerdaten sind in der Cloud gespeichert. Schulen und Schüler hängen buchstäblich im Netz der Cloudbetreiber.
Außerdem ist die Datensammlung und Datenspeicherung in einer Cloud („Big Data“) die Grundlage für das sogenannte individualisierte oder personalisierte Lernen, für das möglichst viele Daten über jeden Schüler erfasst und ausgewertet werden („Learning Analytics“)[13]. Es entsteht ein „Digitaler Zwilling“.[14]
Hierzu der Verein LobbyControl[15]: „Schulen sind ein besonders geeigneter Ort, denn Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen wirkt ein Leben lang.“ Und zusätzlich folgern sie treffend: „Politik lässt sich einfacher für Konzern-Belange einspannen, wenn das Unternehmen auf Zustimmung in der Bevölkerung verweisen kann.“[16]
Auf den Punkt gebracht: Es geht um ökonomische Interessen in Form von Absatzpotentialen für Hard- und Software, Datenüberwachung, Datenspeicherung und Datenhandel[17]. Ein Milliardengeschäft!
Dabei spielt der Bertelsmann Konzern, der größte europäische Medienkonzern mit kompletter Verwertungskette für digitale Lern-Produkte, eine herausragende Rolle. Der gesamte Bildungsmarkt hat weltweit ein Volumen von 5 Billionen US-Dollar[18].
Wer also bei der Frage: Welche Vorteile hat die digitale Entwicklung? nur die Schule und die Schüler im Blick hat, lässt diese ökonomischen und politischen Zusammenhänge außer Acht.
Kernaussagen von vier Studien zum Thema „Digitalisierung in der Schule“:
Die Studie „Bring Your Own Device“[19] der Universität Hamburg, November 2016, kommt zu dem Ergebnis, dass die Nutzung mobiler IT-Geräte im Unterricht weder zu einer messbar höheren Leistungsmotivation, noch zu einer stärkeren Identifikation mit der Schule führt. (S. 42f) Auch eine höhere Informationskompetenz wurde nicht erreicht[20]. (S. 92) Die Analyse der gewonnen Daten macht deutlich, dass mobile Endgeräte ein hohes Ablenkungspotenzial im Unterricht haben[21]. (S. 80, 98) Auch gab es keine Hinweise, „dass die Schülerinnen und Schüler durch die Nutzung der Smartphones und anderer persönlicher Endgeräte innerhalb des Untersuchungszeitraums signifikant höhere Kompetenzniveaus erreichen konnten.“ (S. 109)
Eine Befragung der Teilnehmer ergab: „dass sich die Schülerinnen und Schüler wünschen, dass digitale Medien als eine mögliche Alternative zu konventionellen Lernmethoden gesehen werden, diese aber nicht ersetzen [sollen].“ (S. 104) Die Schülerinnen und Schüler präferieren den gemeinschaftlichen Klassenunterricht und sehen die digitale Technik nur als Ergänzung.
Gutachten des „Aktionsrat Bildung“ der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, „Bildung 2030 – Veränderte Welt. Fragen an die Bildungspolitik“, Mai 2017.
Kernbotschaften:
- die Schule müsse digitaler werden
- am Nutzen der Digitaltechnik [Digitalisierung der Schule] bestehe kein Zweifel.
In der ersten Fassung des Gutachtens, das auch in den Medien verbreitet wurde, war zu lesen, dass „Grundschüler in Deutschland, in deren Unterricht mindestens einmal wöchentlich Computer eingesetzt wurden, in den Domänen Mathematik und Naturwissenschaften statistisch signifikant höhere Kompetenzen aufweisen als jene Grundschulkinder, die seltener als einmal pro Woche Computer im Unterricht nutzen“. Der Deutsche Lehrerverband machte bereits am 22.05.2017 auf die Falschmeldung[22] aufmerksam.
In der darauf korrigierten Fassung heißt es: … niedrigere Kompetenzen … [aus: Bildung 2030 – veränderte Welt. Fragen an die Bildungspolitik, S. 78, aktualisierte Version]
Äußerung einer Sprecherin zu der Falschmeldung: Das ändere aber nichts an den Herausforderungen für die Bildungswelt, die das Gutachten beschreibe. [!]
Anmerkung dazu von Prof. Lankau (Hochschule Offenburg, Fakultät Medien und Informationswesen): „Das heißt auf gut deutsch: Was immer Studien ergeben, die Digitalisierung von Schule und Unterricht bleibt das Ziel der Wirtschaftsverbände und der ihnen zuarbeitenden Wissenschaftler.“[23]
Die Metastudie „Digitale Medien im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe“ [24] wurde im Auftrag der KMK durchgeführt, Dezember 2017.
Die Leiterin der Studie, Frau Professorin Kristina Reiss, TU München, äußert sich zu den Ergebnissen: „Digitale Medien sollten im Unterricht mit Augenmaß eingebaut werden. Es würde über das Ziel hinaus schießen, bewährte analoge Formate zu verbannen. Außerdem sehen wir, dass auch sehr gut gemachte Lernprogramme nicht die Lehrerinnen und Lehrer ersetzen können.“[25] [siehe dazu auch: Stellungnahme zu dieser Studie von Prof. Ralf Lankau, Nebelkerzen statt Aufklärung, 29.01.2018][26]
In der Studie – „Erfolgsfaktoren Resilienz“, der OECD und Vodafone Stiftung[27], veröffentlicht im Januar 2018, wird als ein zentrales Ergebnis die Bedeutung eines positiven Schul-, Unterrichts- und Lernklimas für Resilienz[28] festgehalten. (S. 8)
Hervorgehoben wird eine „wertschätzende und offene Kommunikation“ aller an Schule Beteiligten, eine „vertrauensvolle Beziehung“ sowie eine „niedrige Lehrerfluktuation“. (S. 2)
Die Verfasser führen weiter aus: „eine bessere Ausstattung in der Schule hilft, aber nur, wenn sie den Lernprozess effektiv verbessert und das Gemeinschaftsgefühl stärkt.“ Außerdem wird festgestellt, dass eine bessere Ausstattung mit Computern gerade bei sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern nicht mit besseren Leistungen einhergeht. (S. 7)
Fazit:
Auch bei dem reflexhaften Ruf nach der „digitalen Schule“ kann Unterricht nur so gut sein, wie die Lehrkraft ihn konzipiert und wie klug sie sich der multimedial gestalteten Lehr- und Lernmittel bedient.
Deutlich wird, dass gerade beim Lernen mit digitalen Medien das Frontale erhalten bleibt. Der Lernprozess wird von einem Algorithmus diktiert und der Lehrer zum Coach degradiert. Gerade bei sozial benachteiligten Schülern führt das nachweislich nicht zum Erfolg! Dazu Prof. Ralf Lankau: „Wer also behauptet, digitale Lehrangebote würden die Bildungschancen demokratisieren, die Bildungsoptionen bildungsferner Schichten durch den Einsatz digitaler Techniken erhöhen und die digitale Spaltung aufheben, argumentiert an der Realität vorbei.“ [29] Für die IT- und Medienkonzerne ist die Digitalisierung des Unterrichts ein Milliardengeschäft!
Wie weitere aktuelle Studien[30] aufzeigen, haben viele Schülerinnen und Schüler besorgniserregende Leistungsergebnisse in den Basiskompetenzen Rechnen, Schreiben und Lesen[31]. Auch der Verlust von Sozialkompetenzen, sprachlichem Ausdrucksvermögen und vernetztem Denken lassen sich durch die „Digitalisierung“ nicht verbessern – denn Lernen braucht Beziehung[32].
„Es ist Zeit, dem reflexhaften Ruf nach der digitalen Schule eine pädagogische Reflexion entgegenzusetzen.“[33]
[1] Impulsvortrag beim Kongress Armut und Gesundheit, http://www.armut-und-gesundheit.de/, 20. und 21.03.2018, TU Berlin, Kinder und Medien, Fachforum Nr. 16, von Manfred Fischer, siehe auch: www.schulforum-berlin.de
[2] siehe: BMBF, Digitale Chancen nutzen. Die Zukunft gestalten. Zwischenbericht der Plattform „Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft“, https://www.bildung-forschung.digital/files/BMBF_Digitale_Bildung_Zwischenbericht_A4_webRZ.pdf
[3] ebd. S. 23
[4] Die Deutsche Telekom AG ist ein deutsches und Europas größtes Telekommunikationsunternehmen
[5] Größte Fachgesellschaft für Informatik im deutschsprachigen Raum. Vertritt seit 1969 die Interessen der Informatikerinnen und Informatiker in Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Gesellschaft und Politik.
[6] SAP: Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, größter deutscher und weltweit viertgrößter Softwarehersteller
[7] siehe: BMBF, Digitale Chancen nutzen. Die Zukunft gestalten. S. 3
[8] siehe: Bildung in der digitalen Welt, https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf
[9] ebd. siehe auch S. 9: „Für den schulischen Bereich gilt, dass das Lehren und Lernen in der digitalen Welt dem Primat des Pädagogischen – also dem Bildungs- und Erziehungsauftrag – folgen muss“.
[10] siehe dazu: Bleckmann, Paula (2016): Statement „Medienmündigkeit – welcher Weg führt zum Ziel?“, öffentliche Diskussionsveranstaltung im Bundestag, 09.06.2016; Spitzer, Manfred (2017): „Der Chirurg googelt nicht“. Focus-Money Nr.1, 2017; Lembke, Gerald/ Leipner, Ingo (2018): Die Lüge der digitalen Bildung. Warum unsere Kinder das Lernen verlernen. Redline: München; Lankau, Ralf (2016): Offener Brief an die Kultusministerkonferenz vom 26.06.2016: „Irrwege der Bildungspolitik“; Scheppler, Rene, GEW Wiesbaden, www.BildungsRadar.de; Deutscher Lehrerverband; Hensinger, Peter (2017): Trojanisches Pferd “Digitale Bildung“, S. 12ff; https://www.gew-bw.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/bw/Kreise/Boeblingen/Info/GEW_BB_Digit_Bildung_170621.pdf
Siehe auch Beiträge aus der Tagespresse: Schmoll, Heike (2017): „Ehrenrettung der Tafelkreide“ – Warum Schüler nicht mehr oder besser lernen, nur weil in den Klassenräumen mit Computern gearbeitet wird, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 01.06.2017; Klein, Susanne (2017): „Digitales Geräteturnen“ – Es ist Zeit, dem reflexhaften Ruf nach der digitalen Schule eine pädagogische Reflexion entgegenzusetzen, Süddeutsche Zeitung vom 15.09.2017; Burchard, Amory (2017): „Lehrkräfte glauben nicht an digitale Medien“ – Computereinsatz in der Schule, Tagesspiegel vom 15.09.2017; Schmoll, Heike (2017): „Die Digitalillusion“ – Drei Studien erwecken den Eindruck, als lasse sich Lernen durch digitale Medien revolutionieren, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18.09.2017; Becker, Lisa (2018): „Machen digitale Medien Schüler wirklich schlauer“ – Ergebnisse der Studie „Digitale Medien im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe – Einsatzmöglichkeiten, Umsetzung und Wirksamkeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 02.01.2018.
[11] Hasso Plattner, Gründer des Hasso-Plattner-Institut (HPI), Aufsichtsratsvorsitzender der SAP
[12] siehe: HPI, Die Schul-Cloud, S. 4/5, https://hpi.de/fileadmin/user_upload/hpi/dokumente/publikationen/projekte/schul-cloud_beschreibung_website.pdf
[13] Learning Analytics: Messen, Sammeln, Analysieren und Auswerten von Daten über Lernende
[14] Hensinger, Peter (2017): Trojanisches Pferd “Digitale Bildung“, pad-Verlag, Bergkamen
[15] LobbyControl: ein gemeinnütziger Verein der Transparenz, demokratische Kontrolle und klare Schranken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit fordert, https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/Lobbyismus_an_Schulen.pdf
[16] siehe auch: ifo Bildungsbarometers 2017, S. 17f und S. 37, https://www.cesifo-group.de/DocDL/sd-2017-17-woessmann-etal-2017-09-14.pdf
[17] Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, Juni 2017. Nach Markteinschätzungen kann der Wert persönlicher Daten in naher Zukunft für den europäischen Markt bis zu 440 Euro pro VerbraucherIn pro Jahr betragen. (S. 37), http://www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/Open_Knowledge_Foundation_Studie.pdf
[18] aus: Handelsblatt, 21.10.2014, Relias Learning – Bertelsmann erweitert Bildungsgeschäft mit USA-Zukauf http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/relias-learning-bertelsmann-erweitert-bildungsgeschaeft-mit-usa-zukauf/10870386.html
[19] siehe: Studie „Bring Your Own Device“, Universität Hamburg, November 2016, Abschlussbericht der wissenschaftlichen Evaluation des Pilotprojekts, http://www.hamburg.de/contentblob/7288404/bc43d4c90c2313ad76667d651fbc90e9/data/byod.pdf
[20] siehe auch: Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule, Dr. Heike Schaumburg Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Erziehungswissenschaften, Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, S. 44
[21] ebd. S. 43f
[22] siehe: Deutscher Lehrerverband, 22.05.2017, http://www.lehrerverband.de/presse_Gutachten_Aktionsrat_2017.html
[23] siehe: GBW, Falsch zitiert und falsch gemeldet, 01.06.2017, https://bildung-wissen.eu/fachbeitraege/falsch-zitiert-und-falsch-gemeldet.html
[24] Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) an der Technische Universität München (TUM), Studie: Digitale Medien im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe – Einsatzmöglichkeiten, Umsetzung und Wirksamkeit https://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=3766Volltext.pdf&typ=zusatztext , Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der Kultusministerkonferenz konzipiert und gefördert durch die private Stiftung Mercator
[25] aus: Pressemitteilung, 12.12.2017, TU München, Große Metastudie zur Wirkung digitaler Medien in der Schule, Erfolgreicher Unterricht ist digital – aber nicht ausschließlich, https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/34369/
[26] Lankau, Ralf: Nebelkerzen statt Aufklärung, 29.01.2018, https://bildung-wissen.eu/fachbeitraege/nebelkerzen-statt-aufklaerung.html
[27] siehe Studie „Erfolgsfaktor Resilienz“, OECD und Vodafone Stiftung Deutschland, Januar 2018: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/VSD_OECD_Erfolgsfaktor%20Resilienz.pdf
[28] Resilienz = Herauswachsen aus der Bildungsarmut, Widerstand
[29] Lankau, Ralf (2017): Kein Mensch lernt digital, S. 130, Beltz, Weinheim
[30] siehe Studien: Bildungsmonoitor 2017; IQB-Bildungstrends 2016, Ländervergleich, Okt. 2017; Internationale Schülerleistungsstudie IGLU 2016, Dez. 2017; siehe auch: http://www.tagesspiegel.de/berlin/geheime-daten-des-senats-berlins-drittklaessler-koennen-nicht-schreiben/20950606.html
[31] Tagesspiegel, 13.05.2017, Werner van Bebber, Eine ganze Kleinstadt ohne Schulabschluss: Deutschlandweit scheitern an der Schule rund 47.000 Jugendliche. Jährlich! Anders gesagt: Das Land leistet sich in jedem Jahr die Einwohnerschaft einer kompletten Kleinstadt, die allenfalls zu Aushilfsjobs in der Lage ist.
[32] siehe: Krautz, Jochen (2016): Bildung und Erziehung als Grundlage für das Leben – was könnte Schule leisten?, in: Fromm Forum, 20/2016, Tübingen (Selbstverlag), S. 56-69. https://schulforum-berlin.de/paedagogisch-gestaltete-klassengemeinschaft/
[33] siehe: Süddeutsche Zeitung, 15.09.2017, Susanne Klein, Digitales Geräteturnen in der Schule, http://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-digitales-geraeteturnen-1.3668070
Vortrag als PDF-Datei: Impulsvortrag_Kongress Armut und Gesundheit_24.03.2018