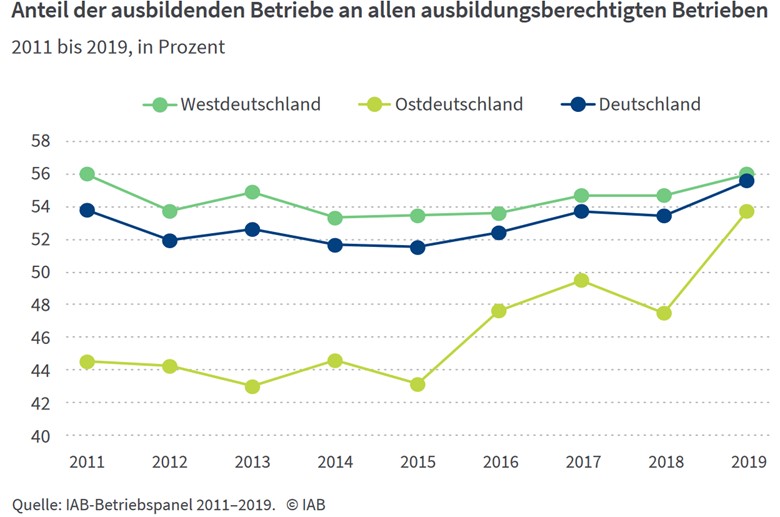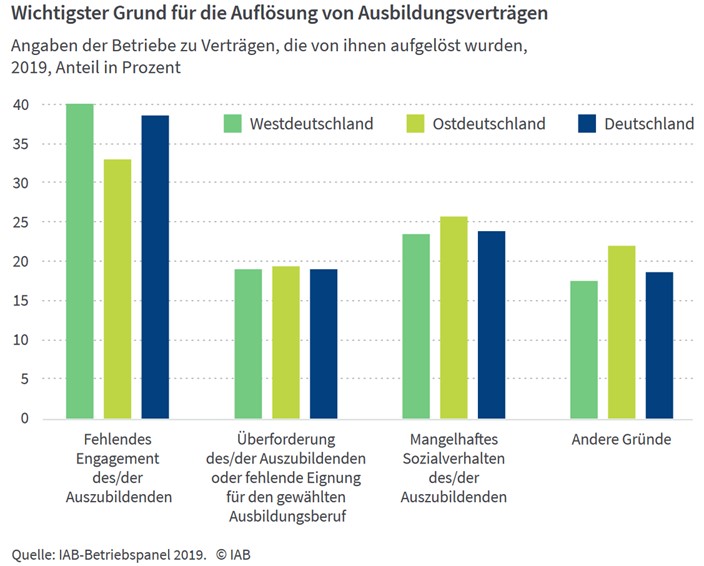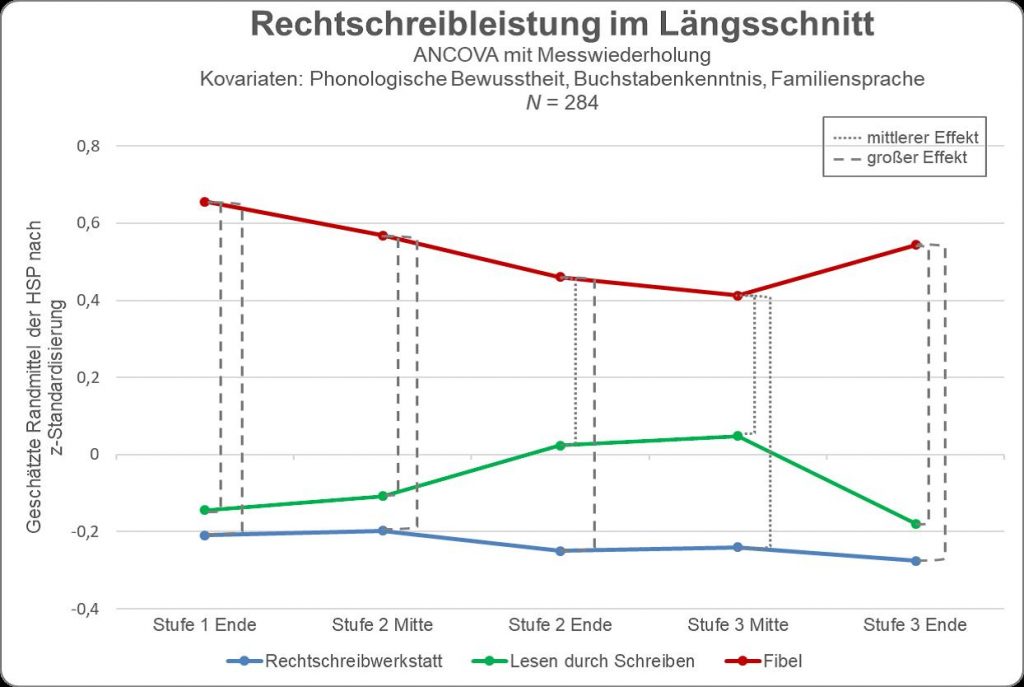Bericht über eine „Brennpunktschule“ im Norden Londons.
Der Schulalltag „ist darauf ausgerichtet, das Lernen zu maximieren und Ablenkung zu minimieren.“
Bericht von Andreas Schleicher, Statistiker und Bildungsforscher. Er ist bei der OECD Direktor des Direktorats für Bildung. [siehe Anmerkung am Schluss des Berichts]
[…] Ein Ort, der seinen Erfolg auf lehrergeleiteten Unterricht aufgebaut hat, ist die Michaela Community School im Wembley Park, einem benachteiligten Viertel im Norden Londons. In jedem Klassenzimmer, das ich beobachtete, machten die Lehrer die Lernziele deutlich, strukturierten ihren Unterricht klar und stellten interessante Fragen, die das Denken höherer Ordnung anregten. Es wurde keine Zeit verschwendet, da die Schüler genau wussten, was sie zu erwarten hatten. Es gab kein Auswendiglernen, das Menschen oft mit lehrergesteuertem Unterricht in Verbindung bringen. Alle Schüler wurden in jedem Moment aufgefordert, alternative Wege zu finden, um Probleme zu lösen und ihre Denkprozesse und Ergebnisse kurz und bündig zu kommunizieren. Und weil die Schüler von Michaela vom ersten Tag an lernen, wie man lernt und hart arbeitet, müssen sie am Ende nicht mehr für die Prüfung üben und verlieren wertvolle Zeit bei der Prüfungsvorbereitung. Es überrascht nicht, dass die GCSE-Prüfungsergebnisse [1] bei Michaela sehr gut sind und Ofsted [2], das Büro für Bildungsstandards der britischen Regierung, die Qualität der Bildung als herausragend anerkennt, was man in dieser Nachbarschaft nicht oft sieht. […]
Die Schulbildung bei Michaela baut auf dem Verständnis auf,
dass das Lernen sequentiell ist und dass die Beherrschung früherer Aufgaben die
Grundlage für die Kompetenz in nachfolgenden Aufgaben ist. Für Lehrer bedeutet
dies, dass sie nicht die Lernziele variieren, die für die gesamte Klasse
gelten, sondern dass sie alles tun, um sicherzustellen, dass jeder Schüler die
Möglichkeit hat, das Material auf eine für ihn oder sie angemessene Weise zu
lernen. In einer der von mir beobachteten Mathematikstunden bot eine Lehrerin
einem der Kinder drei Möglichkeiten an, ihr Verständnis von Brüchen zu
festigen. Und indem sie sie bat, ihre Denkprozesse zu erklären, machten nicht
nur der Schüler, sondern die ganze Klasse Fortschritte. Da es allen Schülern
gelingt, jede aufeinanderfolgende Aufgabe zu erledigen, ist das Ergebnis
weniger Variation und ein schwächerer Einfluss des sozioökonomischen
Hintergrunds auf die Lernergebnisse. […]
Während der lehrergesteuerte Unterricht ein wichtiger Bestandteil der Unterrichtspraxis in der Michaela Community School ist, geht es nicht nur darum, Fakten und Zahlen zu reproduzieren, sondern basiert auf dem Verständnis, dass eine breite und vielfältige Wissensbasis die Grundlage für die Entwicklung einer informierten und differenzierten Meinung ist. Ich habe das während des Schulessens gesehen, als ich mit einer Gruppe von Sechstklässlern an einem „Familientisch“ gegessen habe. Die Kinder waren wach, neugierig und fürsorglich. Sie kamen aus sehr unterschiedlichen ethnischen und sozialen Verhältnissen, teilten eine Identität über das Lernen und waren sehr stolz auf ihre Schule. Sie diskutierten beim Mittagessen das Thema des Tages – was es braucht, um einen Marathon zu laufen – mit dem gleichen Interesse und der gleichen Energie, mit der sie mich mit Fragen über mein Leben und meine Ausbildung überhäuften. Die hohen Anforderungen, die die Schule an sie stellt, haben sie nicht ängstlich, sondern ehrgeiziger gemacht. Sie zielen auf Oxford und Cambridge. Sie hörten mir und einander aufmerksam zu und kümmerten sich darum, dass wir alle genug zu essen hatten. Nachdem die Teller abgeräumt waren, drückten die Kinder von jedem Tisch ihren Klassenkameraden, Lehrern und Eltern ihre „Wertschätzung“ aus und dankten demjenigen, der ihnen besonders geholfen hat.
Als ich Katharine Birbalsingh, die Direktorin und Gründerin
von Michaela, nach dem Mittagessen traf, fasste sie die Fähigkeiten, die sie
unter diesen Kindern entwickeln möchte, als „hart arbeiten und freundlich sein“
zusammen, ein Streben, das ebenso mächtig wie einfach ist. Die Schüler müssen
verstehen, dass Erfolg harte Arbeit erfordert, aber Michaela sorgt auch dafür,
dass Schüler, die Probleme haben, die Unterstützung erhalten, die sie brauchen.
Disziplin ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Jedes Detail des Schultages
ist darauf ausgerichtet, das Lernen zu maximieren und Ablenkung zu minimieren.
[…]
Disziplin [wird] durch Struktur, Vorhersehbarkeit und Eigenverantwortung erreicht. Die Kinder, die ich traf, wirkten glücklich und selbstbewusst. Und das stimmt wiederum mit einer der wichtigsten Lehren aus PISA überein: Ein positives Disziplinarklima ist eine der besten Prognosen für bessere Bildung und soziale Ergebnisse. Kinder schätzen ein schulisches Umfeld, in dem Mobbing ungewöhnlich ist, in dem sie sich nicht unbehaglich oder fehl am Platz fühlen und in dem der Aufbau echter und respektvoller Beziehungen zu Lehrern die Norm ist. […]
Die Schulleiterin Birbalsingh hörte sich die Forschungsergebnisse von PISA mit großem Interesse an, gründete ihre Schule jedoch auf etwas Einfacherem: dem gesunden Menschenverstand.
[1] GCSE = General Certificate of Secondary Education entsprechen in England, Wales und Nordirland etwa dem deutschen mittleren Schulabschluss (MSA). Das GCSE gilt im britischen Schulsystem als die wichtigste Abschlussprüfung für die Sekundarstufe I.
[2] Ofsted, Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills
Übersetzt aus: OECD Education, Where “working hard and being kind” are part of the curriculum, 20.11.2019, Bericht von Andreas Schleicher, Statistiker und Bildungsforscher. Er ist bei der OECD Direktor des Direktorats für Bildung
Anmerkung durch Schulforum-Berlin:
Die Verfasser der von Schleicher erwähnten Pisa-Studie [1] führen weiter aus: „Eine bessere Ausstattung in der Schule hilft, aber nur, wenn sie den Lernprozess effektiv verbessert und das Gemeinschaftsgefühl stärkt.“ Außerdem wird festgestellt, dass eine bessere Ausstattung mit Computern gerade bei sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern nicht mit besseren Leistungen einhergeht. (S.8)
Natürlich kennt Schleicher auch dieses Ergebnis der Studie, das er jedoch in einem aktuellen Interview [2] bewusst verschweigt, denn er sagt: „Die deutschen Schulen sind beim digitalen Lernen [3] weit zurück, das rächt sich jetzt.“ Er führt weiter aus, wie die „Möglichkeiten der Digitalisierung“ genutzt werden sollen. So sind „durch Technik nicht nur herkömmliche Bildungsprozesse effizienter zu gestalten, sondern völlig neue Lernumgebungen zu entwickeln“, und er gibt als Lösung vor, dass diese „das Lernen spannender, relevanter, interaktiver und individueller machen.“ Sein Credo lautet: „Das Land kann beim digitalen Lernen jetzt einen Riesensprung nach vorn machen.“
Wie weit ist doch seine Argumentation von den Ergebnissen der genannten Pisa-Studie sowie den überragenden Ergebnissen der Schulpraxis der von Schleicher geschilderten Michaela Community School entfernt.
Nicht erst seit der Initiierung der Plattform „Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft“ [4] durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Jahr 2015 wird deutlich, dass internationale IT- und Medienkonzerne – mit kompletter Verwertungskette für IT-Geräte und digitale Lern-Produkte – die Rolle als Richtungsgeber bei den Akteuren der Digitalisierung von Bildung eingenommen haben. [5] Anzumerken ist auch, dass die OECD keine Bildungsvereinigung ist sondern die „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“. Der Bildungsmarkt hat weltweit ein Volumen von 5 Billionen US-Dollar. [6] Es geht also um ein riesiges Geschäft!
Unter diesen ökonomischen Vorgaben ist wenig Hoffnung, dass Schleicher mit dem Finger auf das „Zentrale Ergebnis der Studie“ hinweist: „Ein positives Schul- und Unterrichtsklima ist ein Schlüsselfaktor für Resilienz.“ (S. 9)
Viele Schülerinnen und Schüler haben seit Jahren besorgniserregende schlechte Leistungsergebnisse in den Basiskompetenzen Rechnen, Schreiben und Lesen. Auch ist ein zunehmender Verlust von Sozialkompetenzen, sprachlichem Ausdrucksvermögen und vernetztem Denken festzustellen. All das lässt sich durch die „Digitalisierung“ nicht verbessern – denn Lernen braucht Beziehung. [7]
[1] Erfolgsfaktor RESILIENZ – Warum manche Jugendliche trotz schwieriger Startbedingungen in der Schule erfolgreich sind – und wie Schulerfolg auch bei allen anderen Schülerinnen und Schülern gefördert werden kann. Eine PISA-Sonderauswertung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Kooperation mit der Vodafone Stiftung Deutschland.
[2] Interview im Redaktionsnetzwerk Deutschland, 25.02.2020
[3] Kritisch ist anzumerken, dass die Bezeichnung „digitales Lernen“ irreführend ist und eher als positiv konnotiertes, euphemistisches Synonym für die Einführung digitaler Lehr- und Lernmittel im Diskurs genutzt wird [vgl. Förschler, Annina], so auch von Schleicher.
[4] BMBF, Digitale Chancen nutzen. Die Zukunft gestalten. Zwischenbericht der Plattform „Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft“
[5] Förschler, Annina (2018): „Das ‚Who is who?‘ der deutschen Bildungs-Digitalisierungsagenda – eine kritische Politiknetzwerk-Analyse“. In: Pädagogische Korrespondenz, 58/18: S. 31-52. (siehe Bücherliste)
„[D]er Diskurs [wird] über das Veröffentlichen von Strategie- und Positionspapieren, Handlungsempfehlungen, öffentlichwirksamen Studien und Online-Auftritten wirkmächtig beeinflusst und (mit)gestaltet und (auch) darüber Einfluss auf bildungspolitische Entscheidungen und Agenden-Ausrichtungen genommen.“ (ebd. S. 46)
[6] Handelsblatt, 21.10.2014, Relias Learning – Bertelsmann erweitert Bildungsgeschäft mit USA-Zukauf
[7] Krautz, Jochen (2020): Zur Erinnerung: Bildendes Lernen braucht Schule und Unterricht, Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V.
Die Ergebnisse der Michaela Community School zählen zu den besten des Landes.
Die GCSE-Ergebnisse der Michaela Community School, die viermal besser waren als der nationale Durchschnitt, waren die ersten, über die seit ihrer Eröffnung vor fünf Jahren im Rahmen des Programms für freie Schulen berichtet wurden. Gavin Williamson, der Bildungssekretär, sagte, dass „erstaunliche Ergebnisse“ von den freien Schulen erzielt wurden und fügte hinzu: „Wir haben echte Erneuerungen gesehen, echte Veränderungen, und das führt tatsächlich zu besseren Ergebnissen in einigen der am stärksten benachteiligten Teile des Landes.“ (übersetzt aus: Telegraph, 17.10.2019, Camilla Turner, More than half of state school pupils failing to achieve ’strong pass‘ in English and maths GCSEs.)
siehe auch:
Auf dieser Berliner Schule herrschen klare Regeln
„Die Schüler wissen, dass wir sehr konsequent handeln würden“
Schulleiter Michael Rudolph legt bei seinen Schülern Wert auf Disziplin. Und hat damit offenbar Erfolg.