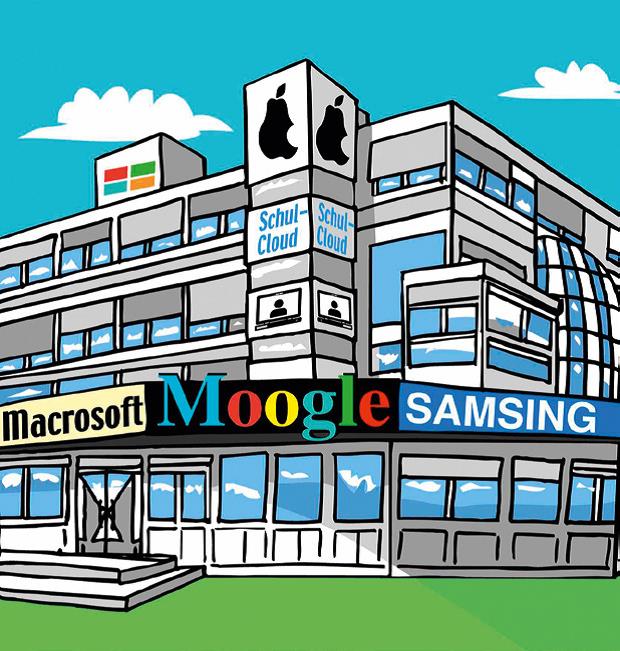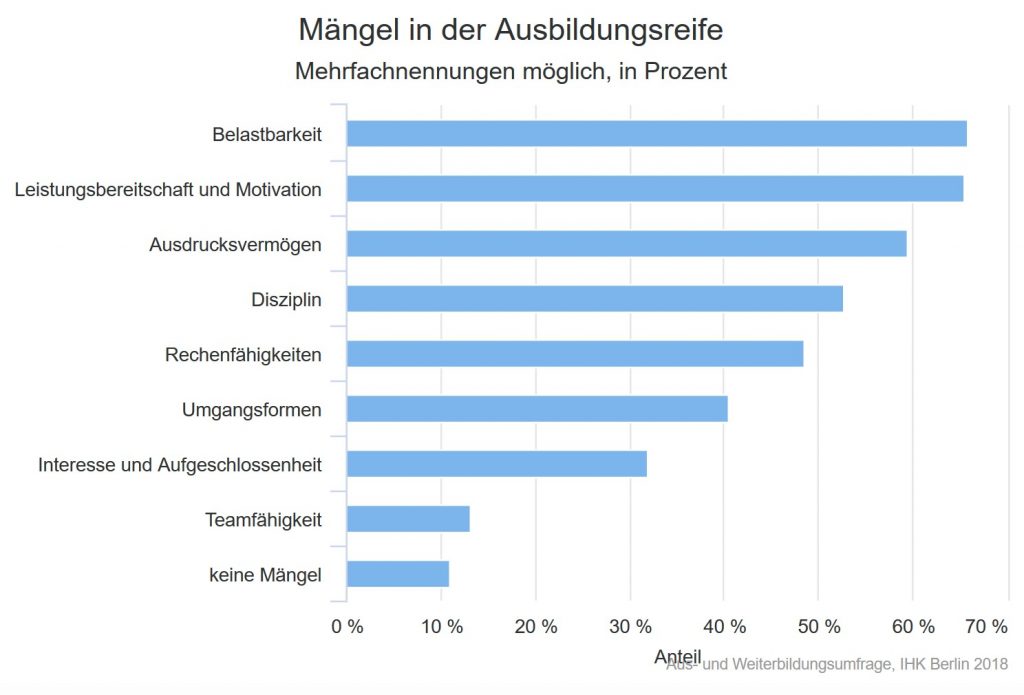Illusionen der Pädagogik
Autorität ist entbehrlich? Wissen ist zweitrangig? Lebensnähe ist alles? Drei Irrtümer. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren des schulischen Lernens liegen auf Seiten der Lehrkraft.
F.A.S. – FEUILLETON, 19.05.2019, Jürgen Kaube
Jürgen Kaube ist seit 1. Januar 2015 Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Träger des Ludwig-Börne-Preises 2015. Autor der Bücher „Die Anfänge von allem“ (2017) über die Entstehung der menschlichen Kultur und „Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?“ (2019) mit einem nachfolgenden Auszug (S. 226 – 234). Siehe auch nebenstehende Bücherliste.
„Ganze Klassen“, schrieben die erstaunten Besucher der Schulen des fernen Landes, „folgen Zeile für Zeile dem, was im Schulbuch geschrieben steht, in einer Geschwindigkeit, die der Lehrer vorgibt. Reihen über Reihen von Kindern tun alle dasselbe auf dieselbe Weise, ob es sich um Kunst, Mathematik oder Geographie handelt. Wir sind von Schule zu Schule gegangen und haben fast identische Schulstunden gesehen, man hätte die Lehrer austauschen können, die Kinder hätten keinen Unterschied gemerkt.“
19. Jahrhundert, die Schule als Maschine, Frontalunterricht. Schon das Wort klingt wie eine Verletzung der Menschenrechte. In diesem Begriff kommt alles zusammen, was am Unterricht streng, unerbittlich, autoritär anmutet. Im Frontalunterricht, so befinden heutige Pädagogen, wird die Lerngruppe als „Plenum“ unterrichtet. Einer oder eine redet vor allen, sie hören zu, sind das Publikum.
Woher aber stammt jenes Zitat? Nicht aus dem 19. Jahrhundert. Sondern aus einem Bericht, den eine britische Forschergruppe 1996 schrieb, nachdem sie sich fünfzig finnische Schulen angeschaut hatte, vier Jahre vor der ersten Pisa-Studie, in der jene Klassen besonders erfolgreich waren. Die Schule also, wie sie vielerorts noch vor kurzem war, erscheint den Anhängern der „konstruktivistischen“ Pädagogik, die vom Kind und nicht vom Lehrer aus unterrichten wollen, wie aus einer fernen finsteren Zeit. Obwohl es 1996 in Finnland eben keine Schule war, in der Lehrer ihren Erwartungen mit Stöcken Nachdruck verschafften, keine Schule, die Arme oder Mädchen benachteiligte, und auch keine, die sinnfremde Unterrichtsstoffe paukte. Sondern nur eine, in der Lehrer als Autoritäten auftraten.
Es gibt dabei keinen Grund, Autorität an das Durchsetzen mechanischen Verhaltens zu binden. Aber es gibt auch keinen Grund, sie zu verachten. Autorität ist nicht die Sache mit dem Stock, mit dem endlosen Monolog, dem Rechthaben, dem Chef-im-Ring-Verhalten. Autorität ist die Sache mit dem „Sie weiß mehr als ich“ und dem „Hier weiß ich mehr“, mit dem „Das kann ich wirklich noch nicht“, dem „Es ist interessant genug, dass ich darüber nachdenke“, dem „Ich höre erst einmal zu, bevor ich losrede“.
Seit der Bildungsforscher John Hattie vor zehn Jahren seine Studie „Visible Learning“ [siehe nebenstehende Bücherliste] über die Erfolgsbedingungen des Unterrichts vorgelegt hat, beginnt sich die Diskussion über die Dogmen des schülerzentrierten Unterrichts zu ändern. Denn die wichtigsten Erfolgsfaktoren des schulischen Lernens liegen ihr zufolge auf Seiten der Lehrkraft. Es geht um die Qualität ihrer Instruktion, ihre Glaubwürdigkeit und Klarheit, das ständige Feedback, das zu geben sei. Es geht um die Befähigung der Schüler, sich auszudrücken und das eigene Niveau einzuschätzen, sowie eine strikte Sequenz aus klar kommunizierten Unterrichtszielen und Erfolgskriterien, modellhaftes Vorführen von Lösungen, Überprüfung, ob alle verstanden haben, und anschließendem Üben. Lautes Denken ist hilfreich, Klassendiskussionen sind es, etwas in eigene Worte zu fassen. Die Autorität der Lehrkraft beruht dabei sowohl auf ihrer Beherrschung des Stoffes und der Deutlichkeit, mit der er dargestellt wird, als auch auf der Fähigkeit, auf typische, aber auch überraschende Fragen zu antworten.
Hinter dem pädagogischen Widerstand gegen all das, gegen direkte Instruktion, gegen den Lehrvortrag und gegen ein immer wieder die Lehrkraft ins Spiel bringendes Unterrichtsgeschehen steckt ein altes Dogma. Es geht auf Jean-Jacques Rousseau zurück und besagt, man lerne nur durch Erfahrung und Selbstreflexion. Sogar das Lesen wollte er seinem fiktiven Zögling, Émile, sich weitgehend selbst beibringen lassen. Auch das später formulierte Prinzip „Learning by doing“ kann so interpretiert werden: als Polemik gegen das Lernen von Tatsachen, Daten, Regeln und ganz allgemein von „Das ist so“-Mitteilungen. Und als Favorisierung von lebensnahen Unterrichtsstoffen, die interdisziplinär und am besten in Form von Projekten angeeignet werden sollen.
Die Kritik des Frontalunterrichts und überhaupt der zentralen Stellung der Lehrkräfte geht insofern stets mit einer Kritik des Wissens und einem Lob der Lebensnähe einher. Kreativität, so eine andere Formulierung derselben Überzeugung, steckt schon im Kind, man muss sie nur entfalten, entwickeln. Die Schule soll aus dem Kind etwas herausholen, nicht etwas in das Kind hineintun.
Aber so sinnlos die Vorstellung ist, am besten befülle man Schüler mit dem Wissenswerten, weil die Welt aus Fakten bestehe, so sinnlos ist die entgegengesetzte Behauptung, alles in der Welt könne gleichzeitig reflektiert, innerlich angeeignet, selbständig und aktiv handelnd erschlossen werden. Und zwar von Schülern jeder Altersstufe. Denn es gibt Sachverhalte ganz unterschiedlicher Erschließbarkeit. Nicht alles kann man sich innerlich aneignen, nicht alles kann gleichermaßen gut verstanden werden, und die Lernpsychologie sagt seit langem schon, dass man manches besser lernt, indem man es erst einmal hinnimmt.
Der Irrtum, dem eine an Fakten desinteressierte Pädagogik unterliegt, besteht darum nicht so sehr darin, dass Fakten als Wissensbestände, als Informationen wichtig wären. Hier haben die Kritiker das Argument auf ihrer Seite, wie viel vergessen wird, wie viel nachschlagbar ist und wie viele Fakten „konstruiert“ sind, also auf komplexen Voraussetzungen beruhen. Doch um die verwegene Behauptung, es sei unterinformiert und womöglich sogar ungebildet, wer nicht wisse, mit welchem Roman der junge Goethe berühmt wurde, geht es gar nicht. Für manche mag es sogar entbehrlich sein zu wissen, wo genau sich Paris befindet.
Der Zweck des Unterrichtens von Tatsachen ist aber nicht, Erfolge in Quizshows zu ermöglichen oder, was dasselbe ist, kleine Enzyklopädisten hervorzubringen. Er liegt zunächst vielmehr darin, dass verstanden wird: Es gibt Tatsachen, jene schwer umgehbaren, kurzen und kontextfreien Ergebnisse einer geregelten Untersuchung, wie die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston Tatsachen definiert. Es gibt also Umstände, auf die man sich verlassen kann. Und von denen aus es weitergeht.
Wenn beispielsweise Paris die größte Stadt Frankreichs ist, kann man andere Städte in Bezug auf sie lokalisieren, wovon Franzosen ausgiebigen Gebrauch machen. Wenn es eine Hauptstadt gibt, gibt es dann auch Nebenstädte? Woran kann man eine Hauptstadt erkennen? Wie wirkt es sich aus, wenn sich die Hauptstadt in der Mitte oder an der Grenze des Landes befindet, eine große oder kleine Stadt ist, und weshalb liegen so viele Hauptstädte an großen Flüssen? Wenn man „Paris“ auf einer Karte von Texas findet, kommt man ins Nachdenken. Mit anderen Worten: Wer nicht ungefähr weiß, was es mit Paris auf sich hat, dem bleiben auch hundert andere Weltaspekte verschlossen.
Der rhetorische Trick der reformpädagogischen Polemik gegen das Wissen besteht also darin, eine relativ armselige Information herauszuziehen – eine Jahreszahl, Eigenschaften eines Lebewesens, die Inhaltsangabe des „Faust“, die Formel für Kaliumnitrat – und dann zu fragen, was es bringt, das zu wissen. Ist es nicht viel wichtiger, historische Kompetenz, Kartenlesekompetenz, literarische Urteilskraft, chemische Denkfähigkeit und so weiter zu erlangen? Eine Frage, die nur bejaht werden kann. Aber der Trick, auf dem die Unterscheidung von sinnlosen Fakten und sinnhaftem Lernen beruht, ist billig. Denn eine einzelne Information ist immer sinnlos. Hundert Informationen hingegen ergeben ein Bild.
Das Einmaleins ist auch so eine Tatsache. Man kann erklären, was das heißt, „Plutimikation“ (Pippi Langstrumpf). Man kann sie aus der Addition herleiten oder aus anderen wiederholten Handlungen. Aber irgendwann sollte 7 × 7 = 49 unabhängig davon, wie man dazu kam, als Routinewissen im Langzeitgedächtnis abgelegt sein und nicht mehr berechnet werden müssen. Und auch hier gilt: dass 7 × 7 nicht irgendetwas ergibt, sondern 49, ist als vereinzelter Merkposten von geringem Wert, das große Einmaleins hingegen ist von unschätzbarem Nutzen. Man nennt es Technik: etwas nutzen, das man nicht vollständig durchdrungen hat. Die Schule besteht nicht allein darin, Techniken zu vermitteln, aber sie besteht auch darin. Passive Wiedergabe und Anwendung hat den Vorteil, effizient und akkurat zu sein, aktive Konstruktion ist hilfreich, wenn das Gedächtnis Schwierigkeiten hat. Und da Eigenproduktion schiefgehen kann, ist es manchmal vorteilhaft, das Wissen einfach mitzuteilen, anstatt es von den Schülern selbst hervorbringen zu lassen.
Nehmen wir die Literatur. Im Deutschunterricht der sechsten Klasse kann es vorkommen, dass die Schüler angehalten werden, eine Geschichte mit unheimlichen Aspekten zu schreiben. Dafür werden sie im fragenden Unterrichtsgespräch mit Wissen darüber versorgt, was Spannung in eine solche Geschichte bringen kann. Sie lernen eine Art Gattungspoetik des Unheimlichen. Ihr sollen sie folgen, und der Deutschlehrer prüft, ob die einzelnen Elemente – harmloser Anfang, etwas Rätselhaftes, irgendetwas im Dunkeln, plötzliche Erlebnisse, überraschende Wendung, Auflösung – von den Schülern reproduziert wurden.
Die „spannungskompetente“ Lösung dieser Aufgabe ist in Ordnung. Aber die originellsten Geschichten kann erzählen, wer schon viele Geschichten kennt. Lesen kommt vor Schreiben. Denn jede Geschichte, die uns fasziniert, besteht aus Geschichten, die wir bereits kennen, und aus Abweichungen von ihnen. „Sei kreativ!“ ist also nicht die beste Anweisung, um Kreativität zu begünstigen. Vielmehr geht Kreativität aus Übungen hervor, die selbst eher repetitiv und auf etwas konzentriert sind, das dem erwünschten Ergebnis gar nicht ähnlich sieht. Fußballspieler, so ein Beispiel des schwedischen Psychologen Karl Anders Ericsson, trainieren nicht, indem sie das Match proben und elf gegen elf spielen, sie üben in viel kleineren Einheiten Pässe, Dribblings, Balleroberung – Routinen als Grundlage von einfallsreichem Spiel. Auf den ersten Blick mag Routine wie ein Gegensatz zum Denken wirken, weil sie erlaubt, auf es zu verzichten. Aber genauer betrachtet ist Routine kein Gegensatz zum Denken: Gedanken zu haben setzt voraus, dass wir über Routinen verfügen, die uns für das Denken entlasten.
Der Irrtum der entgegengesetzten Ansicht, die Schüler sollten sich möglichst früh alles selbständig erschließen, beruht auf einer Verwechslung von Ziel und Methode: Man wird nicht unabhängig dadurch, dass man weitgehend alleingelassen wird. Man lernt nicht denken dadurch, dass jemand fragt, was man über eine Sache denkt. So wie man nicht schreiben lernen kann, nur, indem man zuhört oder liest. Es bedarf der Instruktion. So hat es beispielsweise keinen Sinn, Kindern schon „kritisches Hinterfragen“ abzuverlangen, bevor sie sich in etwas auskennen. Sie lernen dann nur die kritischen Fragen samt den dazugehörigen Antworten auswendig und schreiben in Erdkundetests der Grundschule brav hin, dass der Kalibergbau die Flüsse belastet.
Das führt zum dritten reformpädagogischen Lehrdogma, das die Kritik des Frontalunterrichts und der Wissensvermittlung ergänzt: das Dogma, der Unterricht habe lebensnah und deshalb interdisziplinär zu sein. Denn die wirkliche Welt kenne ja gar keine nach Fachgrenzen aufgeteilten Probleme. In ihr hänge stattdessen alles mit allem oder jedenfalls vieles mit vielem zusammen, und in solchen Zusammenhängen denken zu lernen, sei es, was die Schule den Schülern mitgeben solle. Die Kinder werden als kleine Experten behandelt, als Forscher oder als Reporter oder als Leute, die eine Präsentation vorbereiten müssen. Referate, in denen Recherchen dargestellt werden sollen, setzen heute bereits in der Grundschule ein. Die Schüler sollen etwas tun, das so ähnlich aussieht und sich so ähnlich anhört wie das, was Wissenschaftler und andere Wissensexperten tun: einen Vortrag halten über das, was sie herausgefunden haben. Der maximale Effekt ist nicht selten, dass die Schüler etwas Passendes aus dem Internet abschreiben und dann vortragen. Denn natürlich sind sie in fast nichts von dem, wozu sie etwas sagen sollen, Experten und können es auch von einer Woche auf die andere nicht werden. Was immer in Kindern ist, das herausgeholt und entfaltet werden kann, Expertise ist es nicht.
Die gegenteilige Annahme beruht auf einer Verwechslung von Neugier und Denken. Die Freude am Denken liegt in der Lösung von Problemen, was bedeutet, dass sowohl das Scheitern an Problemen als auch der Umgang mit bereits gelösten Problemen freudlos bleiben. Der Projektunterricht mit seinen dem wirklichen Leben entnommenen Fragestellungen kombiniert oft beides: ein hochkomplexes, jeden Schüler überforderndes Weltproblem, verbunden mit einer Menge irgendwo abrufbarer Antworten. Neugier wird aber nicht durch den Grad geweckt, in dem ein Problem mit der Welt verbunden ist, sondern durch das Ausmaß, in dem es den Schülern so vorkommt, als könnten sie es lösen. Man kann ihnen nicht einreden, dass sie die Lösungen auf die Fragen finden, wie der Klimawandel aufgehalten werden kann, was es mit Patchwork-Familien auf sich hat oder mit Konflikten zwischen Religionen, oder wie man verhindert, dass Kalibergwerke nahe Flüsse belasten. Sie spüren, dass ihnen das Hintergrundwissen dazu fehlt, und fühlen sich nur auf die Suche nach schon gegebenen Antworten geschickt, die irgendwo im Internet versteckt sind.