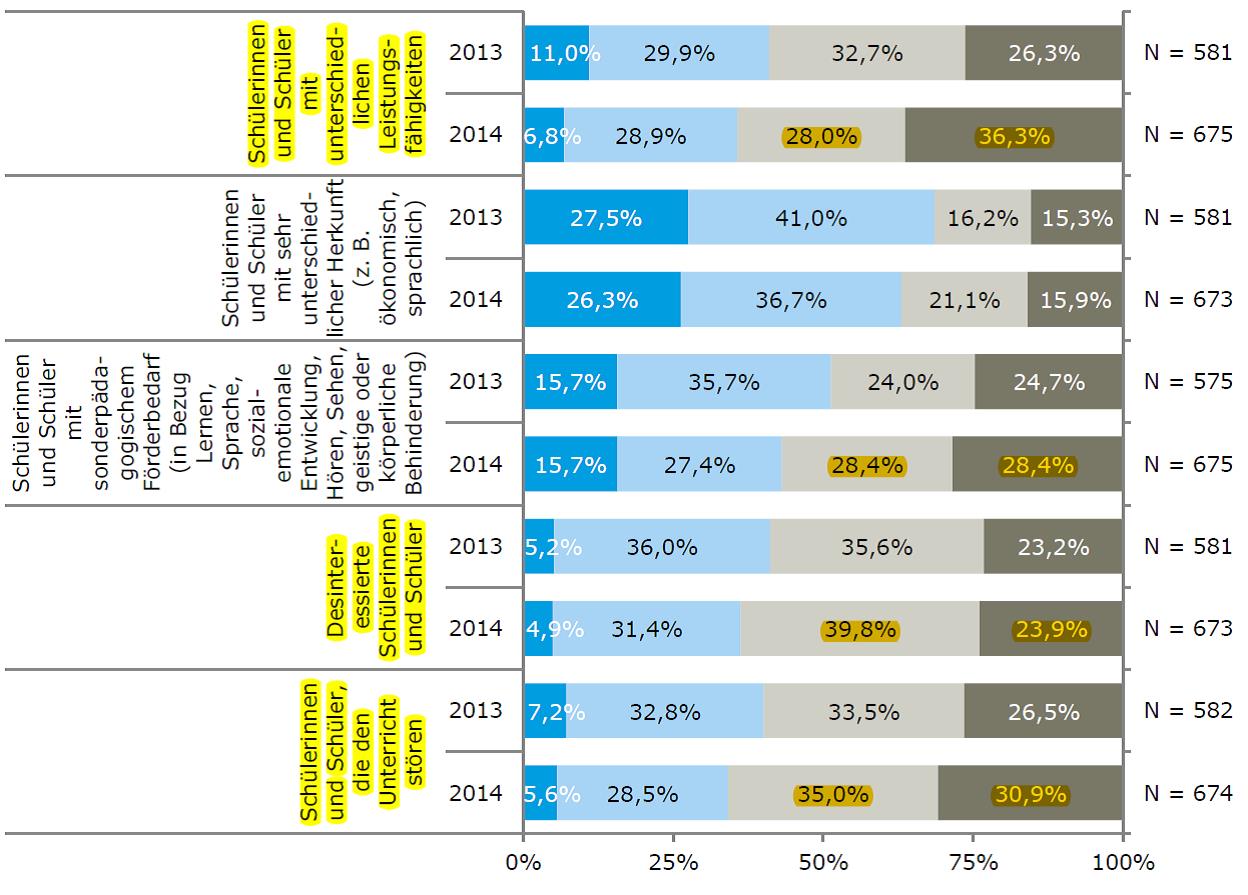»Weltweit größtes Experiment am lebenden Objekt«
Über die falsche Heilslehre vom Digitalen, automatisierte Lernfabriken ohne Pädagogen und die »Verzweckung« unserer Kinder
Ralf Wurzbacher im Gespräch mit Prof. Ralf Lankau
aus: junge Welt, 4.11.2017
Ralf Lankau ist Professor für Mediengestaltung und Medientheorie an der Hochschule Offenburg. Er leitet dort das Labor »Grafik.Werkstatt« an der Fakultät Medien und Informationswesen, forscht zu experimenteller Medienproduktion in Kunst, Lehre und Wissenschaft und publiziert zu Design, Kommunikationswissenschaft und (Medien-) Pädagogik. Lankau betreibt das Projekt »Futur iii – Digitaltechnik zwischen Freiheitsversprechen und Totalüberwachung« (futur-iii.de) und ist Mitinitiator des »Bündnisses für humane Bildung – aufwach(s)en mit digitalen Medien« (www.aufwach-s-en.de). Von Lankau erschien Anfang Oktober im Beltz-Verlag: »Kein Mensch lernt digital: Über den sinnvollen Einsatz neuer Medien im Unterricht« [siehe Bücherliste]
In unserem Gespräch wird es auch darum gehen, wie doof oder klug Smartphones, Tablets und Computer sind bzw. wie dumm oder schlau sie uns Menschen machen. Fangen wir mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner an, der sich im Bundestagswahlkampf mit dem Spruch »Digital first. Bedenken second.« auf Plakaten verewigen ließ. Sollte man sich um diesen Herrn Sorgen machen?
Würde er sein Plädoyer ernst meinen, müsste man sich in der Tat um seine geistige Gesundheit sorgen und ihn als nicht zurechnungsfähig aus dem Verkehr ziehen. Wer die notwendige Reflexion über die Folgen von Digitaltechnik, also die klassische Technikfolgenabschätzung, ausblenden will, kann weder politisch noch als Person ernstgenommen werden. Andererseits passt das ins Bild. Deutschland ist im Digitalfieber: Digitalagenda, Digitalgipfel, Digitalpakte. Die Art, wie diese Technik propagiert und abgefeiert wird, hat etwas von Heilslehre und einem Fetisch. Und auf dieser populistischen Pro-Digital-Welle, die von der IT-Wirtschaft und ihren Lobbyisten losgetreten wurde, reitet eben auch Lindner.
Also Berechnung, keine Dummheit?
Lindner ist nicht dumm. Es geht ihm um Aufmerksamkeit und darum, sich als »Politmarke« aufzubauen. Das Ego und die Karriere einzelner stehen im Mittelpunkt, nicht politische Fragen und sozialverträgliche Lösungen. Und das heißt dann eben auch: Für das Erreichen der eigenen Ziele darf man gerne das politische System beschädigen, koste es, was es wolle.
Die Digitalisierung soll den Steuerzahler ja einiges kosten. Der »Digitalpakt#D«, mit dem Bund und Länder Deutschlands Schulen flächendeckend mit modernster IT- und Breitbandtechnik ausstatten wollen, soll fünf Milliarden Euro verschlingen. Es wäre zu hoffen, dass bei solchen Summen eine eingehende Kosten-Nutzen-Analyse erfolgt.
Eine Kosten-Nutzen-Analyse gab es so wenig wie eine auch nur annähernd realistische Kalkulation. Fünf Milliarden Euro in fünf Jahren, das klingt nach viel Geld. Bei 33.500 allgemeinbildenden Schulen wären das pro Einrichtung und Jahr knapp 30.000 Euro. Nimmt man alle 44.000 Schulen, dann landet man bei etwas mehr als 22.000 Euro. Es gibt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung mit zwei Szenarien. Im ersten teilen sich fünf Schüler einen Computer oder ein Tablet. Dabei ergäben sich nach den Berechnungen Ausgaben zwischen 538 Millionen und 1,03 Milliarden Euro pro Jahr. Hätten, wie im zweiten Fall, alle Schüler ein Endgerät, wäre man schon bei 1,82 Milliarden bis 2,62 Milliarden Euro pro Jahr.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat vorgerechnet, dass alleine die Berufsschulen 2,5 Milliarden Euro in fünf Jahren und damit schon die Hälfte des Geldes vom Digitalpakt beanspruchen. Ein Kostenrahmen weit über dem von fünf Milliarden Euro ergibt sich auch aus einer Kalkulation des Städtetags Baden-Württemberg. All die Beispiele zeigen: Das mit den fünf Milliarden Euro ist Augenwischerei.
Wie verhält es sich mit dem Nutzen? Politik und Wirtschaft bauen ja darauf, dass sich die Digitalisierungsoffensive auf lange Sicht rentieren wird – in Gestalt besser qualifizierter Schulabgänger, Lehrlinge und Studierender. Gibt es dafür belastbare Belege?
Eben nicht, und das macht den Ansatz vollends absurd. Schon die berühmte Metaanalyse »Visible Learning« des neuseeländischen Pädagogen John Hattie, hat gezeigt, dass Rechner und Software in Schulen nichts bringen. Eine PISA-Sonderauswertung der OECD-Studie »Students, Computers and Learning« ergab, dass in den vergangenen zehn Jahren Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen keine nennenswerten Verbesserungen der Schülerleistungen in Lesekompetenz, Mathematik oder Naturwissenschaften erbrachten. Selbst in einer Telekom-Studie steht, was auch bei Hattie zu lesen ist: »Die verstärkte Nutzung digitaler Medien führt offensichtlich nicht per se zu besseren Schülerleistungen. Vielmehr kommt es auf die Lehrperson an.« Andreas Schleicher, OECD-Direktor für Bildung, formulierte es in einem Interview mit einer australischen Zeitung so: »Wir müssen es als Realität betrachten, dass Technologie in unseren Schulen mehr schadet als nützt.«
Woher nehmen dann die Bundesregierung und mit ihr fast der ganze Politikbetrieb bis in die Reihen der Partei Die Linke die Überzeugung, dass Bildung und digitale Medien wie selbstverständlich zusammengehören?
Ich würde das nicht Überzeugung nennen. Claus Pias hat in seiner »Kurzen Geschichte der Unterrichtsmaschinen« das Scheitern der Geräte im Unterricht aufgezeigt. Verdient hat an dieser Lerngutprogrammierung aber immer jemand. In der Diskussion zeichnen sich im wesentlichen zwei Lager ab. Wer mit der Digitalisierung von Schulen und Unterricht Geld verdienen will – Hard- und Softwareanbieter, IT-Dienstleister, App-Entwickler, Medienpädagogen oder Lehrmittelanbieter –, plädiert für den möglichst frühen Einsatz von Digitaltechnik in der Schule oder sogar schon in der Kita.
Wer hingegen Kinderärzte, Kognitionswissenschaftler, Suchtforscher oder Pädagogen fragt, bekommt als Einstiegsalter zehn bis zwölf Jahre genannt. Wer weiß, dass die ersten zehn Lebensjahre für die Entwicklung eines Menschen entscheidend sind, wird einschätzen können, ob die Interessen an Absatzmärkten für Digitaltechnik darüber bestimmen sollten, ab welchem Alter die Geräte in der Schule eingesetzt werden oder doch besser die leibliche und geistige Gesundheit der Kinder geschützt wird.
Soll heißen: Die Politik übernimmt einfach die Position der Industrie?
Ja, hier haben die IT-Lobbyisten ganze Arbeit geleistet. Wir erleben eine kollektive Gehirnwäsche. Bildung, Gesundheit, Verkehr, Wissenschaft, überall gilt die Heilslehre vom Digitalen. Schauen Sie sich die Kampagnen, Websites und Arbeitspapiere aus den Ministerien an und die der IT-Unternehmen. Da weiß man gar nicht mehr, wer was geschrieben hat. Weiterlesen