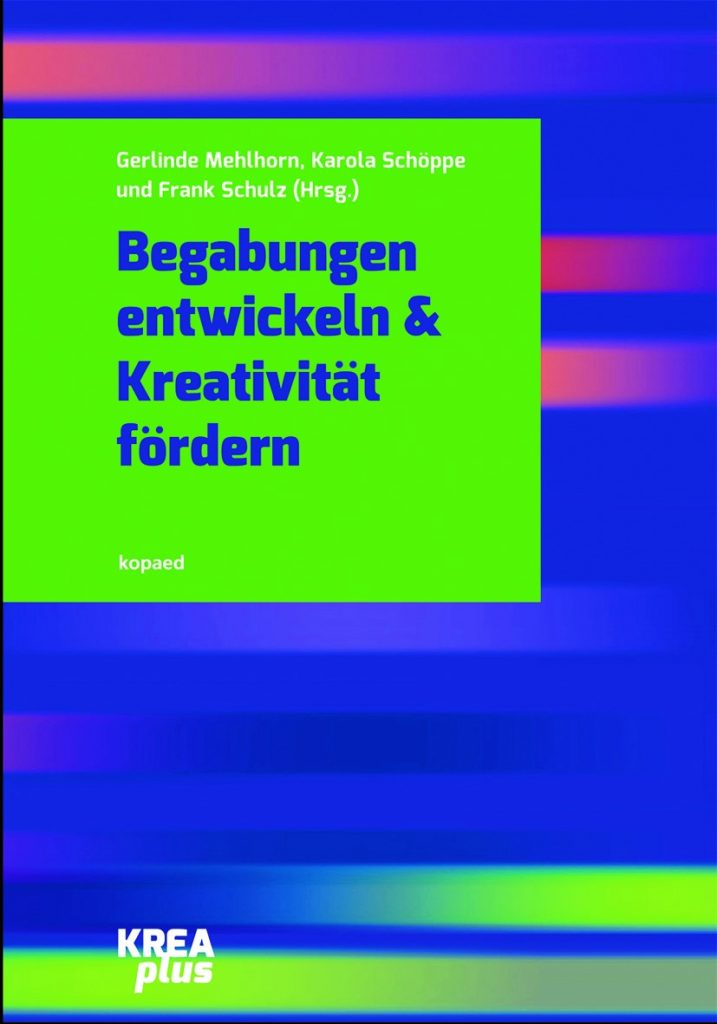„Varat“-Fahren – Rechtschreibung in der Grundschule
Von Heike Schmoll, Sendung: SWR 2, Aula, Sonntag, 28.08.2016
Redaktion: Ralf Caspary
Studien belegen: Deutsche Grundschüler schreiben immer schlechter, beherrschen nicht mehr die Orthografie, die Hälfte der Drittklässler erfüllt nicht einmal mehr die Mindeststandards, die die Kultusministerkonferenz für die Rechtschreibung formuliert hat. Diese Kinder können lediglich so schreiben, wie sie sprechen, und das ist ein Problem. Ursache für dieses Problem ist wiederum eine Methode, die in der Primarstufe an vielen Schulen und in vielen Bundesländern dominiert, es geht um das Schreiben nach der Phonetik. Heike Schmoll, Redakteurin mit Schwerpunkt Bildung bei der FAZ, sagt, warum diese Methode Unsinn ist.
Als im Juli die Lernergebnisse der achten Klassen aller weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg veröffentlicht wurden, war das Entsetzen groß [Ergebnisse siehe “Blamable Schulleistungen“]. Baden-Württemberg hatte zum ersten Mal am bundesweiten Programm Vera 8, einem Leistungsvergleich für die Achtklässler aller Schularten teilgenommen. Im Februar und März wurden die Tests geschrieben, die Ergebnisse sind alarmierend. (…)
Die meisten der heutigen Achtklässler haben Lesen und Schreiben nach einer bizarren Methode gelernt, die unter Praktikern und Fachleuten hoch umstritten ist. Grundschuleltern kennen das: Ihr Kind schreibt in der ersten Klasse Kraut und Rüben, genauso wie es den Klang der Worte wahrnimmt. Manchmal können die Eltern nur schwer erraten, was der Sprössling mit seinen ersten Worten und Sätzen gemeint haben könnte. Den Lehrern geht es kaum anders. Unter eine Schülerarbeit mit phonetischer Schreibung hat die Lehrerin geschrieben: „Ich kann deine Geschichte leider nicht bewerten, da ich sie nicht lesen kann“. Dieselbe Lehrerin, die dem Kind diese aberwitzige Methode zugemutet hat, macht sie ihm zum Vorwurf. Das ist nicht nur absurd, es ist geradezu unverantwortlich. Was kann der Schüler dafür, dass er nach solch einer Methode, die diesen Namen angesichts der fehlenden Systematik nicht einmal verdient, Schreiben und Lesen lernen soll?
Schließlich dient das Schreiben und Lesen in erster Linie der verständlichen Mitteilung. Doch in diesem Unterricht steht es nicht im Dienste der verständlichen Mitteilung, sondern hilft allein der Selbstverwirklichung der kindlichen Fantasie. Das, was Bildungspolitiker immer so groß schreiben, das Gemeinschaftliche an der Schule, wird zugunsten einer ziemlich selbstbezogenen Veranstaltung aufgegeben. (…)
Auch im kommenden Schuljahr lernen wieder Hunderttausende Erstklässler Lesen durch Schreiben und das heißt, Schreiben nach dem phonetischen Klang der Worte. Der Schreibvielfalt sind je nach dialektaler Färbung wiederum keine Grenzen gesetzt.
(…) seit einigen Jahren wird getreu nach Jürgen Reichen Schreiben nach dem Hören gelehrt. Kinder sollen also so schreiben, wie sie ein Wort hören. Reichen war ein Schweizer Reformpädagoge. Er war der festen Auffassung, dass Schüler umso besser lernen, je weniger sie belehrt werden. Reichen glaubte daran, dass Kinder sich die Schriftsprache selbst aneignen können, genauso wie sie einst laufen und sprechen lernten. Mehr als eine Anlauttabelle wollte er ihnen dafür nicht an die Hand geben. Sie zeigt Bilder – ein Fisch schwimmt hinter dem F, eine Tasse erscheint hinter dem T, ein Ü steht für Überholverbot und so weiter. Die Erstklässler sollten von Anfang an die Laute, die sie für das Wort brauchen, selbst aus der Tabelle zusammensuchen. (…) Der sogenannte Grundschulverband hat sie jahrelang mit großem Erfolg propagiert. (…)
Hatten Schüler bis dahin einzelne Buchstaben gelernt, die irgendwann ganze Wörter ergaben, ging es jetzt darum, jedes beliebige Wort in Lautbestandteile zerlegen zu können. Wie Reichen dachte, mag folgender Ausspruch illustrieren: „Dieser gesamte Rechtschreibwahnsinn führt doch zu nichts anderem, als die Schule mit Quark zu beschäftigen. Dadurch halten wir die Kinder davon ab, wirklich denken zu lernen und uns mit der Welt und dem Leben auseinanderzusetzen“, sagte Reichen wörtlich. Auch er hing der Ideologie an, dass Rechtschreibregeln einzig und allein als Herrschaftsinstrument anzusehen seien. (…)
Seit etwa 15 Jahren werden beide Methoden des Schreibenlernens empirisch miteinander verglichen. Die Befundlage ist ziemlich komplex, wenn auch nicht sonderlich überraschend. In den Klassen, die nach der Methode „Lesen durch Schreiben“ lernen, sind die Rechtschreibleistungen deutlich schlechter als in Klassen mit der herkömmlichen Fibel. (…)
Das kreative Schreiben fruchtet wenig, wenn die Anforderungen ohnehin schon auf niedrigstem Niveau sind. Doch alles schien den Reformern wichtiger als Diktate, die völlig aus dem Deutschunterricht verbannt wurden. Ohne Rechtschreibregeln hätte es ja ohnehin nichts zu korrigieren gegeben. Eigentlich sollten die Grundschüler in der dritten Klasse wenigstens annähernd die Rechtschreibung beherrschen, die Korrekturphase sollte in der zweiten Klasse beginnen. Doch das gelingt nicht. Welchen Sinn hat es eigentlich, wenn Kinder Texte produzieren, die weder sie selbst noch andere lesen können? (…) Schließlich ist Lesen und Schreiben in erster Linie ein Kommunikationsmittel und keine sinnfreie Fantasieübung. (…) Letzten Endes müssen die weiterführenden Schulen darauf vertrauen können, dass die Grundschulen die kulturellen Grundlagen vermitteln, zu denen vor allem verständiges Lesen und Schreiben gehören.
Es hat sich inzwischen eingebürgert, in den Aufsätzen der Grundschule Rechtschreibfehler nicht einmal mehr anzustreichen, geschweige denn zu korrigieren. Unweigerlich sinkt das Niveau dadurch. Zugleich wird der verpflichtende Wortschatz für die Grundschule ständig gesenkt. Sollten Grundschüler vor zehn Jahren noch 1200 Wörter sicher beherrschen, sind es inzwischen nur noch 700 bis 800. Die Sprachverarmung ist deshalb vorprogrammiert, zugleich sind die Mindestanforderungen leichter zu erfüllen. (…)
Es gelte sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass die Rechtschreibung am Ende der vierten Klasse der Grundschule fertig ausgebildet sei [so eine der Befürworterinnen der Reichen-Methode Erika Brinkmann von der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd]. Wie man am neuen Vera-Test sieht, gelingt das auch den Gemeinschaftsschulen in den Orientierungsschuljahren 5 und 6 nicht.
Die Grundschulen sind offenkundig nicht imstande, ihren Schüler die kulturellen Standardtechniken Lesen, Schreiben Rechnen so zu vermitteln, dass sie eine weiterführende Schule ohne Schiffbruch bewältigen. (…) Es ist ein Unding, dass es nach wie vor den Lehrern selbst überlassen bleibt, nach welcher Methode sie Lesen und Schreiben lehren, wenn das zu solchen Ergebnissen führt. (…) Allein das saarländische Ministerium für Bildung und Kultur hat festgehalten: „Eine ausschließliche Umsetzung der Methode ‚Lesen durch Schreiben‘ nach Jürgen Reichen verbietet sich“. (…)
Die Potsdamer Professorin für Grundschulpädagogik und -didaktik Agi Schründer hält jedenfalls das Schreiben nach dem Hören für reine Zeitverschwendung und für ziemlich verfehlt. (…) Kinder brauchen einen Umgang mit Fehlern, der konstruktiv ist. Das heißt, sie brauchen die Orientierung am Richtigen und wollen auch wissen, was korrekt geschrieben ist. Alles andere ist Augenwischerei. Die scheinbar kindgemäße Methode des Schreibens nach dem Hören entspricht eher den Wunschvorstellungen von Erwachsenen als den Bedürfnissen von Kindern. Sie speist sich aus der sozialromantischen Vorstellung, dass die gleiche Behandlung von Schülern aus bildungsnahen und bildungsfernen Schichten durch diese Methode des Schreiberwerbs die sozialen Unterschiede weniger hervortreten lasse. Doch das Gegenteil ist der Fall (…) [siehe auch: Die Hälfte der Drittklässler erfüllt nicht einmal die Mindeststandards“]
Die scheinbar sozial verträgliche Methode verschärft also die sozialen Unterschiede und ebnet sie nicht ein. Denn die schwächeren Lerner bräuchten strukturierte Angebote, weil sie ihnen helfen, die Systematik der Rechtschreibung zu erkennen. Genau diese bekommen sie nur in den seltensten Fällen. Wenn sie das Prinzip verstanden und oft genug geübt haben, können sie auch flüssig lesen und schreiben. Und nur wer einigermaßen flüssig lesen und schreiben kann, der hat auch Freude daran. (…) [siehe auch: „Richtig schreiben, lesen und – verstehen“]
Es ist erschreckend: Keines der 16 Bundesländer weiß, nach welcher Methode welche Schule und welcher Lehrer unterrichten. Niemand überschaut noch die Vielzahl der Verfahren und keiner überprüft die Lernergebnisse, die erst dann auffallen, wenn es in den meisten Fällen zu spät ist: bei den Vergleichsarbeiten der dritten und der achten Klasse. (…)
Wie sollen sie denn in einem bunt gewürfelten Lernverband von der ersten bis zur dritten Klasse mit jahrgangsübergreifendem Unterricht zu einem systematischen Spracherwerb und zu einem sicheren Lesen und Schreiben gelangen?
Die Lehrer kapitulieren längst vor diesen unlösbaren Aufgaben: Sie sollen drei Klassenstufen, dazu sprachbehinderten und in der Entwicklung gestörten Kindern gerecht werden und zugleich den einheimischen, eingewanderten und dann auch noch den Flüchtlingskindern die wichtigsten Kulturtechniken vermitteln. Das vermag kein Lehrer zu leisten. (…) Zu viel Heterogenität vergrößert die Leistungsfähigkeit eben nicht, sondern sie macht das Lernen unmöglich. Leistungsdifferenzierte Gruppen sind die einzige Chance, solcher unterschiedlicher Bedürfnisse noch Herr zu werden. (…)
Viele Berliner Schulen reagieren verlegen bis abwehrend, wenn sie nach der Anzahl der Lese-Rechtschreib-Schwachen gefragt werden. Die Zahlen werden auch nicht von der Schulbehörde erhoben – ein Schelm, der dabei Böses denkt. (…)
Wie lange eigentlich sollen Deutschlands Schulanfänger systematisch zu Rechtschreibanarchisten erzogen werden? Warum lassen es sich Eltern gefallen, dass ihre Sprösslinge zu Versuchskaninchen einer Methode gemacht werden, deren Unzulänglichkeit nicht mehr zu übersehen ist? Warum setzen sie nicht Schulleiter unter Druck und machen bekannt, an welcher Grundschule ein guter Rechtschreibunterricht stattfindet?
zum Manuskript: SWR 2, Aula, 28.08.2016, Redaktion: Ralf Caspary, von Heike Schmoll, „Varat“-Fahren – Rechtschreibung in der Grundschule
Hervorhebungen im Fettdruck durch Schulform-Berlin