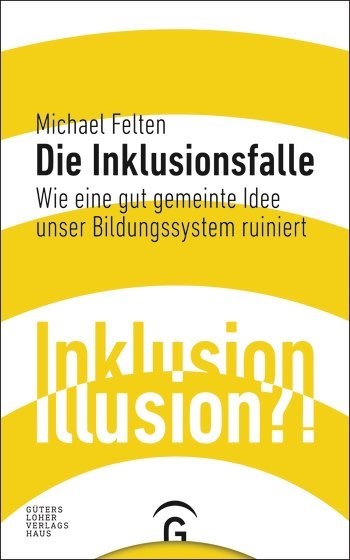Sollten Schüler erst einmal so schreiben, wie sie wollen? – Nein!
Viele Schüler lernen heute nach der Methode „Schreiben nach Gehör“. Das ist eine Zumutung fürs Gehirn. Denn dem fällt es leichter zu üben, als Gelerntes zu korrigieren.
FAZ, Bildungswelten, 06.04.2017, von Rainer Werner, Berlin
Am 4. Mai 2017 werden sich in 400 Berliner Grundschulen 28.000 Schüler der dritten Klassen über ein Aufgabenblatt beugen, das ihnen eine einheitliche Schreibaufgabe abverlangt. An diesem Tag findet der landesweite Test „Vera 3“ im Fach Deutsch statt. Die Berliner Schulverwaltung wird ihn mit Bangen erwarten, und das hat gute Gründe. Beim Vera-3-Test im Schuljahr 2014/2015 waren die Ergebnisse für die Berliner Grundschüler verheerend. Die Hälfte der Drittklässler erfüllte nicht die Mindestanforderungen an die Rechtschreibung, wie sie die Kultusministerkonferenz (KMK) festgelegt hatte. Sie können, wie es im Kommentar des Instituts für Schulqualität (ISQ) hieß, gerade einmal „lautgetreu“ schreiben. Schüler bringen Wörter also so zu Papier, wie sie diese hören, nicht aber, wie sie korrekt geschrieben werden. Auch in den Folgejahren verbessern sich die Schreibleistungen der Schüler nicht, wie die schlechten Ergebnisse beim Deutsch-Test „Vera 8“ belegen.
Vermutlich verwenden viele Lehrer in der Grundschule die Lernmethode, die im Ruf steht, besonders schülerfreundlich zu sein, weil sie sie den Schülern ermöglicht, draufloszuschreiben, ohne sich um Rechtschreibregeln kümmern zu müssen. Es ist die umstrittene Methode „Schreiben nach Gehör“. Das dabei entstehende Textkauderwelsch ist oft nur schwer verständlich: „Di foirwer retete eine oile aus dem Stal.“ Linguisten haben vor diesem Verfahren schon immer gewarnt, weil es in den Köpfen der Kinder die falsche Schreibweise verfestigt, die man mühsam dem regelgerechten Schreiben anpassen muss – ein unsinniger Umweg. In Internetforen bezeichnen Eltern die Didaktik „Schreiben nach Gehör“, die an ihren Kindern ausprobiert wird, als „unterlassene Hilfeleistung“.
Die beiden klassischen Lernmethoden beim Schriftspracherwerb, die silbenanalytische (die Silbe dient als Grundlage der Wortbildung) und die analytisch-synthetische (sie lehrt die korrekte Laut-Buchstaben-Zuordnung), sind der phonetischen Methode deutlich überlegen. Vor allem bei der silbenanalytischen Methode zeigen sich, wie Studien belegen, schon im zweiten Schuljahr beim Lesen und Schreiben sehr gute Resultate. Eine Unterrichtsdidaktik sollte sich eigentlich am zu erzielenden Resultat ausrichten und nicht an psychologischen Kriterien, wie den vermeintlichen Schreibbarrieren der Schüler. Wenn eine Erleichterungsdidaktik zu Misserfolgen führt, dient sie nicht dem Kind. Sie sollte deshalb schleunigst korrigiert werden.
Warum sollte man das Drill nennen?
Es verblüfft einen immer wieder, wenn man Briefe von Menschen liest, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts zur Schule gegangen sind. Sie schreiben in einem nahezu fehlerfreien Deutsch. Dabei haben sie oft nur die achtklassige „Volksschule“ besucht. Ihr korrektes Deutsch haben sie gelernt, weil das Üben der Rechtschreibung mit einer Beharrlichkeit durchgeführt wurde, die „schülerzugewandte“ Pädagogen heute als unmenschlichen Drill stigmatisieren. Vermutlich haben frühere Didaktiker mehr von der Beschaffenheit unseres Gehirns gewusst, als wir ihnen aus heutiger Sicht zugestehen wollen. Die physiologische Gehirnforschung plädiert dafür, Merkfähigkeit vor allem durch beständiges Üben zu stärken. Warum sollte man das Drill nennen, was uns das eigene Gehirn als eine erfolgversprechende Lernmethode vorgibt? Es ist an der Zeit, dass sich die Lehrer gegen die unwissenschaftliche Verächtlichmachung des Übens verwahren.
Um die Ursachen für die schlechten Rechtschreibleistungen der Berliner Grundschüler zu ergründen, lohnt sich ein Blick in den gültigen Rahmenlehrplan Deutsch (2015). Obwohl sich in Berlin inzwischen im Schulsystem ein Zweisäulenmodell etabliert hat, beharrt der Senat darauf, allen Schulformen von Klasse 1 bis 10 einen einheitlichen Lehrplan zu verordnen. Vom Eigenwert gymnasialen Lernens ist nirgendwo die Rede. Bei der Lektüre des Plans springt sofort ins Auge, dass der Mündlichkeit ein unverhältnismäßig großer Stellenwert eingeräumt wird. Das ist nur schwer nachzuvollziehen, da das Schreiben doch die Fertigkeit ist, die Schüler an der Grundschule neu lernen sollen. Den mündlichen Sprachgebrauch bringen sie hingegen mit. Ich habe mich als Lehrer oft gewundert, warum Schüler, die im Unterrichtsgespräch gute Beiträge lieferten, beim Schreiben versagten.
Zwischen Eloquenz und Schreibfertigkeit klaffte eine Lücke. Offenbar verstärkte der tägliche Unterricht das, was die Schüler schon können, sich mündlich flüssig zu äußern, in einer Endlosschleife immer weiter. Die mühselige Entwicklung der Schreibfähigkeit wird von Lehrern um des lieben Friedens in der Klasse willen gerne vernachlässigt. Der Grammatik des Deutschen wird im Rahmenlehrplan Deutsch keine eigene Abteilung zugestanden. Sie wird unter „Rechtschreibung“ subsumiert, was fragwürdig ist. Ein Lernziel lautet: „(Die Schüler sollen) ihr grammatisches Wissen zur Identifikation von Fehlerschwerpunkten nutzen“. Die Grammatik hat also nur eine dienende Funktion zur Vermeidung von Rechtschreibfehlern, wird aber nicht als in sich logisches System verstanden und gelehrt. Zwei wesentliche Begriffe der Grammatik, Syntax und Semantik, kommen daher im Lehrplan gar nicht vor. Wie sollen Schüler aber stimmige Texte schreiben, wenn sie in der Satz- und Bedeutungslehre gar nicht unterrichtet worden sind? Müssen die Gymnasiasten darunter leiden, dass der Rahmenlehrplan das gymnasiale Niveau nicht mehr gesondert ausweisen darf?
Sternstunden des Deutschunterrichts
Die Schulbuchverlage sind dem modischen Trend, die Grammatik in anderen Themenfeldern aufgehen zu lassen, gefolgt. In den Deutschbüchern gibt es keinen eigenständigen Grammatikteil mehr. Grammatische Phänomene werden beiläufig bei der Interpretation literarischer Texte abgehandelt. Entsprechend nachlässig werden sie auch behandelt. Daran ändert auch der euphemistische Begriff des „verbundenen Grammatikunterrichts“ nichts. Ich habe am Gymnasium immer reine Grammatikstunden gehalten. Mal standen die Satzglieder auf dem Programm, mal die Gliedsatzarten oder der Konjunktiv. Kein Schüler hat solche Stunden als geistlose Abrichtung empfunden. Es gab immer Schüler, denen es eine intellektuelle Freude bereitete, in die Geheimnisse der deutschen Grammatik einzudringen. Sie entwickelten einen sportlichen Ehrgeiz, ein präpositionales Objekt von einer adverbialen Bestimmung zu unterscheiden. Das sind doch Sternstunden des Deutschunterrichts.
Wenn schon der Verzicht auf einen eigenständigen Grammatikunterricht die Gymnasialschüler unterfordert, ist das bei der Prüfung zum Mittleren Schulabschluss (MSA) erst recht der Fall. In Deutsch besteht sie aus der Beantwortung von Lesefragen nach dem Multiple-Choice-Prinzip. Das Multiple-Choice-Verfahren ist ein Relikt der sechziger Jahre. Im Deutschunterricht der Gesamtschulen hat man es eingeführt, um Nachteile für Kinder aus Unterschichtfamilien, die beim Schreiben nur über einen „restringierten Code“ verfügen, gegenüber den „elaboriert“ schreibenden Kindern aus der Mittelschicht auszugleichen. Bald kam man von diesem soziolinguistischen Postulat wieder ab, weil man erkannte, dass das Ankreuzen von Kästchen die Entwicklung einer Schreibfähigkeit eher behindert. Mustergültig sind die Deutsch-Prüfungsaufgaben in Bayern, weil sie den Schülern in allen Schulformen einen zusammenhängenden Text abverlangen. Gymnasiasten vorformulierte Antworten ankreuzen zu lassen kann man durchaus als Zumutung empfinden. Die für die für Gymnasiasten überflüssige MSA-Prüfung aufgewandte Zeit könnte man sinnvoller für die Einübung von Arbeitsweisen der gymnasialen Oberstufe verwenden. Dies scheint gerade in Berlin, wo der gymnasiale Bildungsgang nur sechs Schuljahre umfasst, dringend geboten.
Der Senat von Berlin sollte den Rahmenlehrplan Deutsch 1 bis 10 grundlegend überarbeiten. Das Gymnasium muss dabei ein eigenes Leistungsprofil erhalten, das der Besonderheit gymnasialen Lernens gerecht wird. In Grundschule, Sekundarschule und Gymnasium muss der Schriftlichkeit höchste Priorität eingeräumt werden. Dabei sollten den Scharnierstellen der schulischen Laufbahn – Klasse 4, Klasse 6 und Klasse 10 – verbindliche Standards des schriftlichen Sprachgebrauchs zugeordnet werden. Sie müssten in altersgerechter Steigerung die unverzichtbaren Schreibformen umfassen, Inhaltsangabe, Textanalyse und Erörterung. Was auf dem Spiele steht, hat der Sprachforscher Christian Lehmann deutlich formuliert: „Wegen ihres Bildungscharakters hat Schriftsprache in allen Gesellschaften mit einer traditionellen Schriftkultur einen höheren Wert als die gesprochene Sprache.“
Zum Artikel und zur web-Seite des Autors
Der Autor ist Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte in Berlin. Er hält Vorträge zu pädagogischen Themen und berät Schulen bei der inneren Schulreform.
Wenn also nach der „Lesen durch Schreiben“-Methode mit der Anlauttabelle unterrichtet wird, „dann ist es so, dass die Kinder einen Weg in die Schriftsprache gewiesen bekommen, der grundsätzlich einseitig und auch fehlerhaft ist. Man sollte ihnen vom ersten Tag an das anbieten, was richtig ist,“ sagt Agi Schründer-Lenzen, Professorin für Allgemeine Grundschulpädagogik und -didaktik an der Universität Potsdam. Damit scheint sie dem 8-jährigen Jan aus der Seele zu sprechen.
„Also ich würde sagen, dass man schon anfängt, die Fehler zu korrigieren in der Ersten, weil sonst hat man sich da dran gewöhnt zum Beispiel Blatt hinten nur mit einem t zu schreiben. Da kommt auf einmal jemand in der Zwei und sagt, das ist falsch, und das ist falsch. Da kriegt man irgendwie so ein ganz trauriges Gefühl.“
Aus: Deutschlandfunk, 28.08.2014, Aus Kultur- und Sozialwissenschaften, Streit um die richtige Methode
Weitere Artikel zu diesem Thema siehe an der Seitenleiste unter: Schule und Lesen + Schreiben